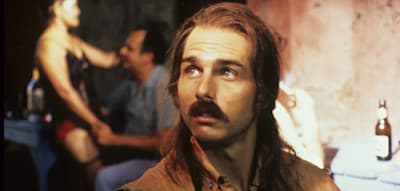Im Jahr 1994 erschien eines der seltenen literaturwissenschaftlichen Bücher, die auch jenseits des Fachs immens wirkungsmächtig waren. Das Buch hieß „Verhaltenslehren der Kälte“, der Autor war der 1939 in Mönchengladbach geborene, seinerzeit im niederländischen Utrecht lehrende Literaturwissenschaftler Helmut Lethen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Mitte 50. Der Titel verstand sich als Oberbegriff für eine ganze Reihe von „Lebensversuchen zwischen den Kriegen“.
Versuche, die sich, Literatur geworden, in den Jahren, die auf den Ersten Weltkrieg folgten, bei Autoren links wie rechts rekonstruieren ließen: in Texten von Bertolt Brecht, Ernst Jünger, Walter Serner und allen voran bei Helmuth Plessner. Dessen anthropologischer Einsicht, formuliert 1924 in „Die Grenzen der Gemeinschaft“, wonach der Mensch „von Natur aus künstlich“ sei, könnte dieser „neusachlichen Stoa“ (Ulrich Raulff), auf die Lethen aufmerksam machte, wohl insgesamt als Motto dienen.
Kurz gesagt ging es bei dem, was Lethen „Verhaltenslehren“ nannte, um Begriffe wie Distanz statt Nähe, Physiologie statt Psychologie, Gesellschaft, nicht Gemeinschaft, Kälte und nicht Wärme. Im Nachwort der 2022 erschienenen Neuauflage der „Verhaltenslehren“ bekannte Lethen: „‚Schein zivilisiert!‘– ich hatte mir eine Devise der Hofkultur aus Protest gegen den Authentizitätskult der achtziger und neunziger Jahre zu eigen gemacht“. Damit war auch auf Balthasar Gracians „Handorakel der Weltklugheit“ und dessen Ideal der „kalten persona“ angespielt, eine Schrift aus dem spanischen Siglo de Oro, die in Arthur Schopenhauers Übersetzung unter neusachlichen Autoren mehr als ein Geheimtipp war. Walter Benjamin schenkte sie Bertolt Brecht, Ernst Jünger las sie, während er Einsatzbefehle schrieb. In seinem neuen Buch „Stoische Gangarten“ bekräftigt Lethen den polemischen Charakter der „Verhaltenslehren“, wenn er betont, ihre Provokation habe im „Angriff auf den Kult der Betroffenheit der achtziger Jahre“ gelegen.
Dieser Angriff war keine Feier des Amoralismus und Antihumanismus tout court, wie das manch ein Kritiker behauptete und einige Gegner einer heute vermeintlich grassierenden Hypermoral glauben, die in Lethen einen Kronzeugen im Kulturkampf sehen. Der Romanist Werner Krauss beispielsweise, schrieb Lethen 1994, habe die Konstruktion von Graciáns „persona“ mit der Idee des Widerstands aus Gründen der Moral verknüpft. Plessner wiederum habe fast 20 Jahre vorher „traditionell negativ bewertete Merkmale wie Anonymität, Aufenthaltslosigkeit, Zerstreuung und Seinsentlastung als Möglichkeitshorizont begrüßt, ohne den sich eine Existenz nicht auf spezifisch humane Weise verwirklichen kann“.
An Lethens Betonung der für Deutschland „ganz außerordentlich positiven Haltung“ des Anthropologen Plessner zur Öffentlichkeit wird sich erinnern, wer dem Begriff im Buch „Stoische Gangarten“ wiederbegegnet. Genauso wie an Werner Krauss, der, schrieb Lethen damals, dem avantgardistischen Habitus der „Kälte“ den Wert des „Maßes“ entgegengesetzt habe: „Mittlere Tugend verlangt höchste Geistesgegenwart. In ihr werden die Extreme nicht gelöscht, sondern im Sinne der Lebensmöglichkeit vermittelt. Der Ausgleich der Leidenschaften führt nicht zu fadem Kompromiss, sondern zur Leidenschaft des Ausgleichs im Dienste eines besonderen Interesses, das politisch, ökonomisch und moralisch bestimmt ist. ‚Diskrete Verwegenheit‘ und ‚besonnener Wagemut‘– warum sollten sich die mittleren Tugenden nicht einbürgern?“
Paradoxe Situationen
Und vielleicht erinnert man sich bei der Lektüre des neuen Lethen-Buches auch an jene Sätze aus dem Rückblick auf die „Verhaltenslehren“ von 2022, wiederum zu Plessner: Dessen Schrift entnehme Lethen nun, schrieb er da, „den Ratschlag, zu erkennen, dass wir politisch die Verschränkung beider Sphären ernst nehmen und vermeiden sollten, die Gemeinschaftssphäre bzw. die Bestimmung ihrer Grenzen einem ‚rechten‘ Lager zu überlassen. Denn wir leben in beiden Sphären.“
Was die Öffentlichkeit angeht, spürt man 2025 die Resignation des 86-jährigen, dessen Gewährsmänner für den „fast utopischen Gedanken“ ihrer Gleichgewicht stiftenden Leistung jetzt aber nicht mehr Plessner und Krauss, sondern Oskar Negt und Alexander Kluge heißen. Von dem Traum in der ‚Öffentlichkeit‘ freie Atemluft vorzufinden, in der wir das Gleichgewicht von Empathie und Sachlichkeit gewinnen könnten, seien wir heute weiter entfernt, meint Lethen jetzt, als vor einem halben Jahrhundert die beiden Autoren von „Öffentlichkeit und Erfahrung“.
Ohnehin herrscht gedrückte Stimmung in diesem Alterswerk: Lethen, der hier wie so oft in seinen späteren Büchern und Texten Autobiografisches, Ideengeschichtliches und Zeitdiagnostisches miteinander verknüpft, sich mit persönlichen Fluchterfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg, der Ableistung seines Wehrdienstes und der Zeit als Kader einer maoistischen Splitterpartei auseinandersetzt, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die eigene Ratlosigkeit angesichts der Weltenläufte von heute geht.
Sei ihm in der Zeit nach 1968 („anscheinend“, wie er einschränkend schreibt) noch klar gewesen, worin die spezifische historische Konstellation jener Jahre bestanden habe, empfindet er nun, „dass die Zukunft leer und drohend auf uns zukommt. Wir leben in einem Raum, in dem politische Paradoxe Handlungslähmung bewirken und Handlungslähmungen Paradoxe plausibel erscheinen lassen.“ Angesichts eines begründeten „strukturellen Pazifismus“ (Sönke Neitzel), dessen Geschichte in einem langen, letzten Kapitel („Einsamkeit und Rheinmetall“), in dem die Ardennenschlacht, Kriegsheimkehrer, Stalingrad-Romane, „Landser“-Hefte und Werbung von Rüstungskonzernen auf Fußballer-Trikots mit dem soziologischen Befund einer um sich greifenden Vereinzelung und Einsamkeit gerade in der jüngeren Generation konfrontiert werden, die einer genauso begründeten Forderung nach Wehrhaftigkeit im Wege stehe, sei die doch zwangsläufig an die Existenz eines Gemeinschaftsgefühls gebunden, fragt sich Lethen: „Wie soll man sich aus den Verschränkungen dieses Spannungsfeldes lösen?“ Und wiederholt: „Jede als paradox begriffene Situation erzeugt Handlungslähmung.“
So düster aber Lethens Gegenwartsdiagnose ausfällt, so luzide, ja gelegentlich hoffnungsvoll präsentiert er sich dort, wo schon immer seine große Stärke lag: In präzisen Lektüren, die in den „Stoischen Gangarten“ etwa die Möglichkeit einräumen, „der Realismus der Abstürze ethischer Normen“, denen ein Ernst Jünger sich mit Leidenschaft hingegeben habe, habe „auch Energien des Aufschwungs gefördert, die später seine Distanz zu den Verbrechen der Diktatur erklären können.“
Und vielleicht liegt auch in der von Georg Büchner übernommenen Forderung, „Geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden“ ein Gegengift gegen die nach Peter Sloterdijk für Hochkulturen charakteristische Möglichkeit, Empathie nach Belieben „auszuschalten und wiederanzuschalten“. Auch Büchners Forderung kommt, in bezeichnender Abwandlung, übrigens bereits in den „Verhaltenslehren“ vor. Ihrem Ursprungsort, dem Revolutionsdrama „Dantons Tod“, widmet Lethen eine brillante Analyse, die dem Leser näherbringt, was eine stoische Gangart vermag. Lethen ist überzeugt: „Diesem ‚Gang‘ fallen nicht nur die Parolen der Französischen Revolution oder jene von Lenin bis Mao zum Opfer. Seiner Logik unterliegen nicht nur viele Grundsätze der politischen Philosophie, sondern auch humanistische Losungen, mit denen bis heute alles imperial Machbare und selbst Militärinterventionen legitimiert werden.“
Helmut Lethen: Stoische Gangarten. Versuche der Lebensführung. Rowohlt Berlin, 224 Seiten, 24 Euro. Ab 12.8.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.