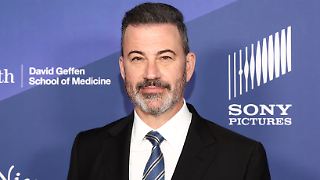Berlin sei das beste Filmset, hier könne man jedes Genre drehen, sagt Helge Jürgens vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Auch das Programm der Berliner Serienkonferenz Seriesly gleicht einem Ritt durch die Genres – von Sci-Fi, wenn es um die KI-bedrohte Zukunft der Filmbranche geht, über Sozialkritik, wenn die Reform der Filmförderung in die Mängel genommen wird, Coming of Age, wenn Nachwuchstalente ihre Ideen pitchen, bis hin zum (Erotik)-drama, wenn Drehbuchautorin Marlene Melchior über den Entstehungsprozess der „steamy“ Erfolgsserie „Maxton Hall“ plaudert, oder wenn bei der nächtlichen Ballroom-Party in einem Berliner Hotel Gossip ausgetauscht und neue Allianzen geschmiedet werden.
Beim internationalen Branchentreffen im Fotografiska, dem ehemaligen Kunsthaus Tacheles, geht es um die ganz großen Fragen: Wie steht es um die deutsche Filmbranche? Sind die kurzen glorreichen Zeiten der Streamer schon wieder vorbei? Und dürfen wir wie Jean-Luc Godard dem „Ende des Kinos mit großem Optimismus entgegenblicken“?
In seinem Eröffnungs-Vortrag „Are we content with content?“ (auf Deutsch sinngemäß: Sind wir mit den Inhalten zufrieden?), zitiert der serbische Regisseur Igor Simić die Philosophin Simone Weil, die Aufmerksamkeit als die seltenste und reinste Form der Großzügigkeit charakterisiert hat. Wie aber ist es in Zeiten von TikTok und künstlicher Intelligenz um unsere Aufmerksamkeit bestellt? OnlyFans und Kubrick würden durch das Internet gleichgemacht, argumentiert Simić, denn alles sei jetzt flach. Flache Handys, flache Bildschirme, flache Welt. Kunst sei zu reinem, von Martin Scorsese als Junkfood diffamiertem „content“ verkommen, dem sich selbst Politiker wie Barack Obama verschrieben. Aktuell erlebten wir einen „context collapse“, stellt Simić fest.
Im „Techno-Feudalismus“ (Yanis Varoufakis) beherrschten wenige mit „Digidopamin“ arbeitende Unternehmen, was wir täglich sehen und konsumieren. Spotifys KI-Algorithmen generierten den perfekten Content-Match, sodass „Leute Musik genießen, wenn sie gut genug ist, um ignoriert zu werden“. Kunst als störfreies Hintergrundrauschen. Serien wie „The Last of Us“ und „Minecraft“ würden immer häufiger als reine Add-ons zu Video-Spielen entworfen, blieben diesen allerdings stets untergeordnet, da man im Spiel eins werde mit den Charakteren. „Was der Klimawandel für den Planeten ist, ist Content für die Kultur“, resümiert Simić, ohne jedoch mit einer gänzlich pessimistischen Note enden zu wollen. Der Überraschungserfolg „Adolescence“ sei ein Beispiel für eine aktuelle Serie, die sich sowohl inhaltlich mit der Aufmerksamkeit für unsere Kinder und wiederum deren Aufmerksamkeit auseinandersetze, als auch formal unsere Aufmerksamkeit fordere.
Endzeitliche Stimmung
Ähnlich endzeitlich geht es im Panel „Storytelling 2030: Who Pays, Who Plays?“ zu. Von zunehmend schrumpfenden Budgets ist da die Rede, von einem von Unsicherheiten geprägten Markt. Die Filmindustrie stürze sich auf immer weniger große Produktionen wie „Squid Game“ und sei außerdem besessen von IPs (Intellectual Property), also bekannten Vorlagen wie „Harry Potter“, „Barbie“ oder „Batman“. Neue, frische Ideen bedeuteten immer ein Risiko, das einzugehen immer weniger Entscheidungsträger wagten.
Tacheles redet hier nicht nur Henning Kamm, Produzent der aktuell erfolgreichen Serien „Krank Berlin“ und „Call My Agent“. Die Frage, worauf es ihm bei Serien ankomme, beantwortet er mit dem Preis. Gemacht werde das, was bezahlbar sei. Auch Lasse Scharpen, Produzent des deutschen Oscar-Beitrags „In die Sonne schauen“, lässt die Temperatur im Saal augenblicklich um drei Grad abkühlen, wenn er im Jahr 2030 sowohl eine dritte Präsidentschaft von Donald Trump kommen sieht, als auch ankündigt, die siebte Staffel der Jugendserie „Echt“ auf TikTok auszustrahlen – anders seien junge Leute nicht mehr fürs Fernsehen zu gewinnen. „Wir ändern den gesamten Prozess; es ist, als würden wir wieder laufen lernen“.
Vergeblich sucht man den Optimismus auch beim Gespräch über die deutsche Filmförderung. Die Produzenten Johannes Kagerer und Jakob Weydemann schwärmen von Frankreich und Südkorea, wo es, anders als in Deutschland, schon eine Investitionsverpflichtung in inländische Produktionen gibt und insgesamt mehr dafür getan werde, um sicherzustellen, dass das eigene Land weltweit als große Filmnationen wahrgenommen werde. Das deutsche Steueranreizmodell von 30 Prozent sei nicht genug. „Deutschland schöpft sein Potenzial noch nicht aus.“
Nicht nur werde die Entwicklung neuer Stoffe in Frankreich besser gefördert, auch gingen die Franzosen siebenmal so häufig ins Kino wie die Deutschen. Schwierig sei außerdem, dass die deutschen Zuschauer ihre nationalen Produktionen stiefmütterlicher behandelten als andere Nationen. Während Franzosen gerne heimische Produkte konsumierten, schielten die Deutschen lieber nach Amerika.
Was Filmemacher umtreibt
Ein klassisches Henne-Ei-Problem oder Symptom eines fehlenden deutschen Selbstbewusstseins? Nirgends etwa wurde die international Rekorde brechende Teenie-Serie „Maxton Hall“ so sehr bespöttelt wie in ihrem Herkunftsland, wo man sich darüber mokierte, dass deutsche Schauspieler mitten auf einer englischen Elite-Universität Deutsch sprechen. Die Drehbuchautorin Marlene Melchior, die im Writers‘ Room der ersten Staffel saß und den Writers‘ Room der im November anlaufenden zweiten Staffel leitet, verweist hingegen lässig auf Shakespeare: Der habe auch englische Stücke über Leute in Dänemark oder Italien geschrieben.
Welche Themen treiben junge Filmemacher nun um? Die aus über 200 Einsendungen ausgewählten Bühnen-Pitches von Nachwuchsautoren handeln von queeren Halb-Hexen in der Schweiz, von Kannibalen, die auf Menschenfleisch verzichten wollen, aber nicht wissen, wie sie das ihrer Kannibalen-Familie beibringen sollen, von einer Demokratie in der Krise, die nur durch das Wiederzusammenkommen zweier Expartner gerettet werden kann, sowie von vaterlosen jungen Männern, die mit Problemen kämpfen, aber immer nur zu hören bekommen, dass sie selbst das Problem seien. Also fast wie die deutsche Filmbranche.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.