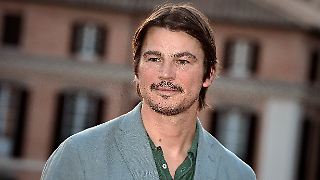Das Mädchen, das kleinen deutschen Boomern wie mir nachhaltig die Herzen und Hirne auf links verdrehte, wohnte von 1973 an in den Katakomben eines kleinen Amphitheaters am Rande einer großen offensichtlich italienischen Stadt. Wer mühselig und beladen war, kam zu ihr. Sie saß da und machte eigentlich nichts und alles, was es braucht um eine Gemeinschaft zu bilden und Freundschaften zu stiften und Probleme zu lösen.
Momo – dunkle Locken, schwarze Augen, schwarze Füße. Bis dann die Kapitalisten kamen und alles veränderten. Graue Herren, die wahrscheinlich rochen wie all meine guten Onkels. Mit dicken Zigarren, gerollt aus den Blättern der Stundenblume. Deren Geschäftsmodell war es, die Menschen davon zu überzeugen, ihre Zeit in der Zeitsparkasse anzulegen für später. Weswegen sie keine Zeit für nichts mehr hatten. Schon gar nicht für so etwas Überflüssiges wie Gemeinschaft, Freundschaft.
Michael Ende hatte sieben Jahre an der Geschichte von Momo getüftelt. War währenddessen nach Italien geflohen, vor der deutschen Kritik, die ihm das Märchenhafte, das Parabelhafte, das angeblich Unpolitische an dem vorwarfen, was er schrieb. Ein Eskapist sei er. Die Kritiker mochten dann auch Momo nicht. Und auch nicht den Film von Johannes Schaaf, der gut zwölf Jahre später in die Kinos kam und in dem Ende, der Literaturfilmskeptiker, der selbst mal Filmkritiker war, neben Mario Adorf und Armin Mueller-Stahl als Sidekick auftrat.
Eine „ganz und gar unabgründige, treudeutsche Hausbackenheit“ sei ihm eigen. Seine Bilder wollten, hieß es, nach Schafskäse riechen und nach Chianti. Und Momo mittendrin sei nicht viel mehr als ein „Allegoriechen“.
Die absichtlich unsaubere Geschichte von Momo, in deren Erzählung Ende Märchen und Politik und Moral und Zeitphilosophie verwirbelte, hat das alles überlebt. In 53 Sprachen, in 13 Millionen Exemplaren. Die Boomer haben es ihren Kindern vorgelesen und die den ihren.
Und weil die Boomer möglicherweise inzwischen ganz oben in der Filmindustrie angekommen sind und alles neu auf die Leinwand bringen, was sie mal an der Bettkante gehört und im Dreiprogrammefernsehen ihrer Eltern gesehen haben, sitzt Momo jetzt im gar nicht kleinen Amphitheater des kroatischen Pula und hört zu.
Viel Zeit hat sie nicht in Christian Ditters neuer Adaption. Vielleicht hat bei Rat Pack, der Filmproduktion, die schon für „Fack ju Göhte“ verantwortlich war und für Ditters „Wickie auf großer Fahrt“, einer der grauen Damen und Herren die Herrschaft über die angepeilte Spieldauer übernommen. Aber zu dem Verdacht vielleicht später mehr.
Der Filmindustrie hat Michael Ende mal vorgeworfen, von ihr würde – weil sich die armen Märchen nicht wehren können –, deren „Gehalt verhunzt und ihre Poesie in supermarktgemäße Konfektionsware verwandelt“. So weit würde man angesichts von Ditters Momo für das 21. Jahrhundert nicht gehen. Obwohl von Poesie gar keine und von Märchenhaftigkeit nicht sehr viel die Rede sein kann in dem Anderthalbstünder. Der jagt wie jenes ultramoderne deutsche Elektromobil, für das er zwischendurch mal kurz Werbung machen darf, an sämtlichen, sorgfältig und aufwändig modernisierten Stationen des Momoschen Kreuzwegs zur Erlösung der Menschheit vom Bösen des Selbstoptimierungswahns und der radikalen Zeitökonomie entlang.
Musik macht jetzt Tokio Hotel
Zurück zu Momo. Die ist immer noch eine Botschafterin des analogen Zeitalters. Sie besitzt einen Schallplattenspieler. (Angelo Branduardi, das zur Entwarnung für alle, die sich noch an Johannes Schaafs Italien erinnern können, kommt nicht mehr vor. Musik, das zur Warnung für alle Boomer, macht jetzt unter anderem Tokio Hotel). Die Welt, in der sie lebt, ist eine unsaubere Mischung aus dem Italien der Fünfziger und der Gegenwart. Nichts riecht hier mehr nach Schafskäse und Chianti und die „treudeutsche Hausbackenheit“ (von der schon in Schaafs Film keine Rede sein konnte) ist Momos Geschichte auch völlig abhandengekommen.
Die Uhren ticken, noch bevor der Vorspann überhaupt richtig gestartet ist. Man stürzt in die Handlung. Figuren wurden aus Gründen der Zeitökonomie zusammengeführt. Beziehungen auf den neuesten Stand gebracht. Gigi Fremdenführer wurde zu Gino, Sohn einer migrantischen alleinerziehenden Fast-Food-Budenbesitzerin, der mit einem Tuktuk Pizzen ausfährt, wenn er nicht gerade Geschichten erzählt.
Wo Momo bei Johannes Schaaf minutenlang Zeit des Zuhörens hatte, einen Kanarienvogel von seiner Stummheit zu heilen, braucht sie jetzt für die Wunderheilung nur vor dem Käfig zu stehen, schon tiriliert er lauthals los. Es ist viel Behauptung in diesem Film.
Die Zeitsparkasse ist bei Ditter eine Parabel auf Zuckerbergs Meta. Die Grey Corporation entfremdet ihre Kunden mittels Greycelets von ihrer Welt. Sie zeigen ihnen an, wann sie Zeit, die sie sich vielleicht besser für später aufsparen sollten, wenn sie sich perfekt optimiert haben, verschwenden. Grey-Linsen locken Greys Kunden aus ihrer Gegenwart in virtuelle Realitäten. Und weil die Kinder deswegen keinen mehr haben, der sich um sie kümmert, werden sie von einer Armee schicker grauer Greydealer, die – wie schon angedeutet – alle denkbaren Geschlechter vertreten – mit „Bibbi Bots“ versorgt, den perfekten Roboterbuddys.
Die grauen Damen und Herren inhalieren die Zeit, die ihnen von Grey gegeben ist, natürlich nicht mehr mittels Zigarren. Sie dampfen Stundenblumenblätter in Vaporizern, was sie in ein Heer von Asthmakranken verwandelt. Die ganze Dystopie von Momo 2.0 kulminiert in Gino, der aus dem Amphitheater aufsteigt zu einem Social-Media-Gott mit 150 Millionen Followern, dem aber nichts mehr einfällt, was darüber hinausgeht, was ihm sein zielgruppengerecht agierender Writers Room über Kopfhörer vorspricht.
Je länger, desto mehr kommt Ditters „Momo“ die Farbe abhanden. Der Brutalismus der Stahlstadt übernimmt die extrem schick und teuer aussehende Ästhetik wie das Nichts Phantásien in Endes „Unendlicher Geschichte“ (die müsste man auch neu verfilmen; obwohl: besser nicht).
Meister Hora hätte gegen sie keine Chance. Er hütet in seinem geradezu auenländischen Haus die Halle des Stundenbaumes (die aussieht wie der Raum gewordene Traum eines jeden Anthroposophen) und damit die Zeit, die uns Menschen bleibt. Keine Chance hätte er vor allem, weil Martin Freeman ihn als leicht verhuschten Träumer gibt, der sich, als es um Leben und Tod geht, zum ersten Nickerchen seines Lebens hinlegt.
Er bleibt ein Allegoriechen. Wie – von der computeranimierten Schildkröte Cassiopeia vielleicht abgesehen – alle anderen Bewohner dieser Nahzukunftwelt. Sie sind prominent besetzt – Kim Bodnia ist, was Mario Adorf war, Beppo Straßenkehrer, Claes Bang ist der oberste Graue. Alexa Goodall gibt sich als Momo alle Mühe, Schwerelosigkeit und Ruhe in ihre zunehmend stahlschwere und hektische Geschichte zu bringen. Es wird einem trotzdem so kalt im Kino, als säßen lauter graue Herren um einen herum. Weil Ditter – wir deuteten es an – halt selbst einer ist. Er hat den Figuren geraubt, was für sie das Wichtigste ist, was sie und uns am Leben hält – Zeit.
Immerhin muss niemand Sorgen haben, dass Herz und Hirn einer kommenden Generation davon auf links gedreht werden. Passt also ganz gut in diese Zeit, diese Momo.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.