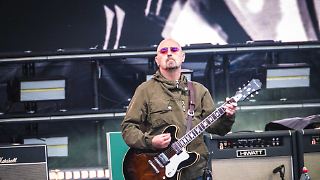Als Friedrich Merz vor wenigen Tagen die Öffentlichkeit informierte, dass die Zeit des Friedens vorbei sei und die regelbasierte Weltordnung durch pure Machtpolitik abgelöst werde, dürfte dabei kaum jemand an Friedrich Nietzsche gedacht haben, zuletzt der deutsche Bundeskanzler selbst. Doch drängt sich der Philosoph, 125 Jahre nach seinem Tod und kurz nachdem sein Nachlass ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde, mit seinen berühmten Formulierungen als Gegenwartskommentator auf. Herrscht nun, wie Merz meint, allein der „Wille zur Macht“? Agieren die großen Männer der Politik als „Übermenschen“ im „Jenseits von Gut und Böse“? Und ist nicht zuletzt die Zeit der „Zeitenwende“ auch die von Nietzsche erträumte „Umwertung aller Werte“?
Wer wissen will, wie viel Nietzsche-Renaissance in der Jetztzeit steckt, muss sich auf den Weg in die Schweizer Zauberberge des Engadins machen, nach Sils Maria, wo der migränegeplagte Philosoph seine Sommer zu verbringen pflegte. Dort, abgeschieden vom politischen Getöse im Grandhotel Waldhaus, treffen sich jedes Jahr Forscher und -Interessierte beim Nietzsche-Kolloquium. Nachdem die Stiftung Nietzsche-Haus bereits im vergangenen Jahr den Nihilismus als Gegenwartsdiagnose auf die Tagesordnung setzte, rückt man dieses Jahr mit dem Thema „Gerechtigkeit und Gewalt“ noch näher an die heftigen innen- und außenpolitischen Verwerfungen der westlichen Welt heran.
Ist der von Merz konstatierte Abschied von der Werteordnung als Triumph des Nihilismus zu verstehen? Herrscht nun Gewalt, wo früher Gerechtigkeit waltete? Der renommierte Jurist Urs Saxer, unter anderem Experte für Völkerrecht und Präsident der Stiftung Nietzsche-Haus, stellt in seinem Vortrag zwar Nietzsches „Wille zur Macht“ dem „Ewigen Frieden“ von Immanuel Kant entgegen, um die Sache anschließend vom Kopf auf die Füße zu stellen. Denn was stiftet und garantiert das Recht, selbst Kants „Weltbürgerrecht“? „Die Gewalt gibt das erste Recht, und es gibt kein Recht, das nicht in seinem Fundamente Anmaßung, Usurpation, Gewalttat ist“, wird Nietzsche von Saxer zitiert. So einfach lassen sich Recht und Gewalt also nicht voneinander trennen.
Wie Marx hat Nietzsche nie die Erzählung des Bürgertums geglaubt, dass die Sphäre des Rechts und der Verträge unter die „gewaltfreie Kommunikation“ fällt, zumindest so lange Verträge unter Ungleichen geschlossen werden. Anatole France spottete bekanntlich über das Gesetz in seiner „majestätischen Gleichheit“, das es Reichen wie Armen verbiete, unter Brücken zu schlafen oder zu betteln. Wer Ungleiches gleich behandelt, stiftet keine Gerechtigkeit, auch wenn es so scheint. So betrachtet, schränkt das Recht Gewalt nicht nur ein, sondern verdeckt oder verlängert es gar. Für Marx folgt aus der falschen Gleichheit die Ausbeutung, für Nietzsche die Einschränkung der Macht selbst – und das Ressentiment derer, die sich zurückgesetzt und zu kurz gekommen fühlen.
Nietzsche hat die Schattenseiten einer verrechtlichten Welt gesehen. Und vor allem hat er gesehen, welche Macht- und Gewaltverhältnisse im Recht weiterhin toben und welche – wie das Ressentiment – dadurch noch angefeuert werden, wie sie sich heute im Populismus zeigen. Wer aber von der Gewalt nicht sprechen will, soll vom Recht schweigen, ließe sich mit Nietzsche sagen. Für die internationalen Beziehungen stellt Saxer fest, dass die beste bisher bekannte Garantie des Rechts ein Machtgleichgewicht sei, auch ein „Gleichgewicht des Schreckens“ oder ein nukleares Patt wie im Kalten Krieg. So kann sich auch der außenpolitische Realismus heute auf Nietzsche berufen.
Bei seinem luziden Vortrag spricht Saxer von einem „nietzscheanischen Moment“, der heute in der Luft liegt. Ein Eindruck, der durch die meisten Vorträge des Kolloquiums verstärkt wird, die ungewöhnlich häufig das Tagesgeschehen – von Verstößen gegen das Völkerrecht bis zum Aufstieg rechter Bewegungen und Parteien – mit Nietzsches Denken konfrontieren. Der nietzscheanische Moment, das scheint übereinstimmend geteilt zu werden, ist der Moment, in dem der über der Gewalt liegende Schleier des Rechts, der dünne Firnis der Zivilisation, wie Sigmund Freud von Saxer zitiert wird, gelüftet wird. Nur wozu? Um sich des Rechts zu entledigen oder um es am eigenen Maßstab zu messen?
Die über dem Kolloquium schwebende Frage lautet: War Nietzsche ein Analytiker der Macht oder ein Apologet derselben? Die gleiche Frage stellt sich auch für seine Leser, damals wie heute. Ein abgründiges Kapitel Rechtsgeschichte eröffnet Sophia Gluth mit den „düsteren Experimenten von Nietzsches juristischen Epigonen“, wie es die Juristin nennt. Josef Kohler, einer der wichtigsten Juristen des Kaiserreichs und begeisterter Nietzsche-Leser, wollte das Recht dem „Willen zur Macht“ unterordnen, um eine Elite zu züchten. Weiter in der offenen Verrechtlichung der Gewalt ging Werner Best, der Jurist der Gestapo und im Reichssicherheitshauptamt („Generation des Unbedingten“). Für den Nietzsche-Leser Best, so Gluth, sollte das Recht wie das Leben sein: ewiger Kampf.
Wer gegen Naturrecht und Menschenrechte ins Feld zog, konnte sich auf Nietzsche berufen. Der Philosoph ist wirklich kein Rechtspositivist und Verfassungspatriot im Sinne von Jürgen Habermas gewesen. Und er hat Mikro- und Makroaggressionen nicht nur nicht verurteilt, sondern gar begrüßt – wie beim „Freitäter“ Napoleon, von dem er die „Vermännlichung Europas“ erhoffte, wie der Historiker Thomas Maissen zeigt. Wobei es eine ironische Dialektik hat, dass Napoleon nicht nur die Gewalt, sondern mit dem „Code civil“ auch das bürgerliche Recht über Europa brachte, wogegen die von Nietzsche besonders verachtete und gehasste deutsche Nationalromantik rebellierte. Das Ressentiment gegen Napoleon schien ihn mehr zu stören als Napoleons Feldzüge.
Hätte Nietzsche heute Wladimir Putin als Wiedergänger Napoleons gefeiert, der gegen den verweichlichten Westen kämpfen will? Oder Donald Trump als „blonde Bestie“? Mit polemischem Schwung zeigt Ute Frevert („Verfassungsgefühle“) Nietzsche als Denker der Disruption avant la lettre und Chefideologen des Vibeshifts. Für die Historikerin ist der nietzscheanische Moment vor allem die Stunde der Nietzsche-Fanboys, die noch im Erwachsenalter ihren adoleszenten Umsturzfantasien frönen: von Alexander Dugin, dem Propagandisten eines eurasischen Reiches, bis zum umtriebigen Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel, der Demokratie für unvereinbar mit der Freiheit hält. Man kann auch an das vom US-Kriegsminister Pete Hegseth beschworene „Krieger-Ethos“ denken.
Für Frevert begeht Nietzsche die Ursünde eines bis heute viralen Denkens, das an die Stelle natürlicher Menschenrechte den Gedanken einer „Höherzüchtung“ setzt – mit allen brutalen Konsequenzen. Auch das gehört zu Nietzsches, mindestens zu seiner Rezeption. Es gibt aber auch den Nietzsche, der sich angesichts seiner traumatischen Erfahrung als freiwilliger Sanitäter im Krieg von 1871 in die Kunst der Antike flüchtet, wo er ein Gegenprinzip zu erkennen meint: Spiel statt Krieg, Schein statt Kampf. In ihrem Vortrag stellt die Philosophin Martine Prange einen Nietzsche vor, der die Ästhetisierung des Lebens nicht als Fortsetzung der Politik und des Krieges entwirft, sondern als Bruch.
Auch in der Erziehung kann man, im Stellungskrieg zwischen „Schwarzer Pädagogik“ und Anti-Pädagogik, Nietzsche heute fruchtbar machen, argumentiert Eva Geulen. Wie die Rechtsverhältnissen sind auch Erziehungsverhältnisse ohne Macht oder Gewalt kaum zu denken, zeigt die Leiterin des Berliner Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung am Beispiel von Kant und Hegel, die die Freiheit bei dem Zwange kultivieren wollten. Wovor Geulen mit Nietzsche sowie Hannah Arendt und Walter Benjamin warnt, ist eine Verzweckung – und letztlich Politisierung – der Erziehung. Gerecht ist die Erziehungsgewalt nur, wo der Mensch als Selbstzweck bestehen bleibt – durch Nachahmung und „zauberische Einwirkung von Person auf Person“, so Geulen.
Nietzsche als Erzieher? Geulens Ausflug in die Erziehungsgefilde und ihr Plädoyer für die Orientierung an Kanon und Vorbildern ist abseitig nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick geht es um die in manchem Vortrag vor lauter Gewalt fast vergessenen Gerechtigkeit, weil Nietzsche auf eine reine, der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen dienende Gewalt zielt, die gerecht in sich ist. Weder „Keine Gewalt!“ noch „Der Zweck heiligt die Mittel!“, sondern eine Kritik der Gewalt, die sich frei von Illusionen, aber nicht von ethischer Reflexion macht. Auch wenn das heute mit Blick auf die moralisierende Entgrenzung des Gewaltbegriffs seit den 1970er Jahren eher gewöhnungsbedürftig wirkt.
Gibt es bei Nietzsche einen Ausweg aus der Gewalt? Oder nur die ewige Wiederkehr der Herrschaft und den Willen zur Macht? Nietzsches Beitrag liegt eher darin, dass er das bürgerliche Recht nicht als Ausweg gelten lässt. Er selbst stellt sich ein „Jenseits des Rechts“ vor, wo es zur „Selbstaufhebung der Gerechtigkeit“ kommt: durch Gnade. So stellt sich auch heute der nietzscheanische Moment vor allem als Moment der Entscheidung dar: Was tun mit dem über der Gewalt liegenden löchrigen Schleier des Rechts? Nur zurecht zuckeln oder wegziehen? Und an das rühren, was darunter liegt? Nietzsche könnte etwas wie einen „dritten Weg“ weisen, zwischen ausgehöhlter Werteordnung und purer Machtpolitik. In Sils Maria geht die Diskussion jedenfalls weiter, nächstes Jahr über neue Fundamentalismen und Nietzsches „Antichrist“.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.