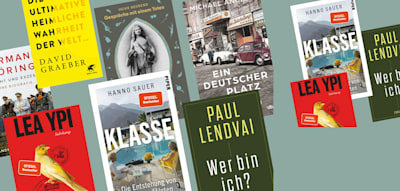Einmal wäre es mir beinahe gelungen, mit Thomas Pynchon zu sprechen. Das kam so: Unser Nachbar Max, ein freundlicher Einwanderer aus Brasilien, der in seinem Garten regelmäßig mit einer kleinen Gruppe von Freunden Jazz spielte (sein Instrument war die Trompete) – Max also erwähnte in einem Nebensatz, dass er Pynchon ganz gut kenne. Eigentlich nicht überraschend: In der Literaturszene war allgemein bekannt, dass Pynchon Jazz liebte. Und überhaupt ist es natürlich ein dummes Klischee, dass es sich bei Thomas Pynchon um einen Einsiedler handelt, er ist ja nicht J.D. Salinger. Pynchon traf sich in New York mit Freunden zum Kaffee, er wurde beim Spazierengehen im Riverside Park gesichtet. Es gab nur so gut wie keine Fotos von ihm; eines zeigt ihn als 16-Jährigen, ein anderes als Matrosen, auf beiden Bildern hat er lange Hasenzähne, die ihm angeblich peinlich sind.
Befragen ließ er sich dazu nie, denn Pynchon spricht grundsätzlich nicht mit Reportern. Aber vielleicht würde er eine Ausnahme machen, wenn Max, der Jazz-Trompeter, sich für mich verbürgte? Es musste ja kein langes Interview sein. Drei zitierenswerte Sätze hätten genügt. Leider kam es nie dazu, denn einige Wochen später war Max verschwunden: Er zog mit seiner Frau nach Arizona, um seiner mittlerweile erwachsenen Tochter näher zu sein.
Dies hätte nun selbst der Auftakt zu einem Pynchon-Roman sein können. Zunächst der irre Zufall (mein Nachbar kennt einen weltberühmten Autor!), dann das plötzliche Verschwinden einer Schlüsselfigur – dahinter musste naturgemäß eine jener Verschwörungen stecken, die es in quasi jedem Pynchon-Roman gibt. Wahrscheinlich hätte ich in Arizona auch noch jazzbesessene Außerirdische getroffen, wenn ich Max nachgereist wäre, und wäre dabei zur blassen Nebenfigur in einem der ausufernden, von Wortspielen und Nebenfiguren übersättigten Bücher von Pynchon verkommen – labyrinthischen Gebilden, in denen immer nur zwei Dinge sicher sind: Erstens, der Kapitalismus ist schlecht; zweitens, die moderne Technik bringt uns um den Verstand.
„Der große, alte Unsichtbare“
88 Jahre ist Thomas Pynchon jetzt alt. Und nun ist in Amerika sein neuer Roman erschienen: „Shadow Ticket“. Salman Rushdie, der Pynchon den „großen alten Unsichtbaren“ genannt hat, munkelte laut „The New Republic“, in den zwölf Jahren habe Pynchon an einem telefonbuchdicken Werk gearbeitet, das den amerikanischen Bürgerkrieg zum Thema habe. Die ersten Reaktionen auf Pynchons Alterswerk können, so gesehen, eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen: Das Buch ist gar nicht dick, es sind gerade mal 300 Seiten, und es handelt auch nicht vom amerikanischen Bürgerkrieg, sondern von Käse.
„Shadow Ticket“ spielt in Milwaukee im Jahr 1932, später dann auch in Budapest. Ein Privatdetektiv namens Hicks McTaggart, der an hartgesottene Ermittler á la Philip Marlowe erinnert, treibt sich in einer absurden Landschaft herum und sucht die verschwundene Tochter eines Käsegangsters. Der Plot, so Dwight Garner, Kritiker der „New York Times“, lese sich wie eine Abfolge von Riesenschlagzeilen in der Boulevardpresse: „Käsefälschung greift um sich, ‚bolschewistische‘ Farmer in Kollektiven bedrohen den großkapitalistischen Status quo … die ‚Roquefort-Polizei‘ und die ‚Gorgonzola squadri‘ treiben sich herum.“ Er sei nicht gegen diesen Roman, aber insgesamt, so Dwight Garner, sei dies „die am wenigsten bemerkenswerte Sache“, die Pynchon je geschrieben habe.
Alastair McKay, der den Roman für das Internetmagazin „Uncut“ rezensiert hat, entdeckt in dem Buch jede Menge Parallelen zu unserer Zeit: „Shadow Ticket“ spielt in einer Vorkriegsepoche, der Faschismus droht, der Judenhass wird täglich stärker, auch Amerika ist nicht mehr sicher. Es geht um „Gangster, Verschwörungsgläubige, Wahlmauscheleien und in Gänsefett geröstetes Popcorn“, und die schlimmste Branche ist die New Yorker Immobilienmafia. Interessanterweise befindet Kathryn Schulz, die Kritikerin des „New Yorker“, Thomas Pynchons neuer Roman habe – im Gegenteil – kaum etwas mit unserer Wirklichkeit zu tun: Sein neunter Roman sei weder eine Satire noch ein Handbuch des Überlebens noch ein Schwanengesang noch ein „Hab ich’s nicht immer gesagt?“. Im Übrigen ist auch Kathryn Schulz ein wenig müde von all den Wortspielen und barocken Nebenhandlungen. Laura Miller, die das Buch für „Slate“ rezensiert hat, fand wenigstens ein paar der Witze gelungen. Überhaupt, darin sind sich die Herren und Damen Kritiker dann doch einig, sei der neue Roman ziemlich lustig.
Umstritten war Pynchon immer
Thomas Pynchon war schon immer ein umstrittener Autor. Auf der einen Seite standen jene, die ihn mit Melville, James Joyce, Nabokov verglichen, auf der anderen Seite jene, die ihm vorwarfen, seine Bücher erinnerten mehr an knallige Comic-Strips als an Literatur: die Figuren flach und ohne Innenleben, die Handlung oft hanebüchen. Pynchons Roman „Die Enden der Parabel“, den manche für sein Meisterwerk halten, sollte 1974 eigentlich den Pulitzer-Preis bekommen – die Jury hatte sich einstimmig für ihn entschieden. Aber die Entscheidungsträger senkten den Daumen: „Die Enden der Parabel“ sei nicht nur schlecht geschrieben, sondern außerdem noch obszön. Als Folge wurde der Pulitzer-Preis für Literatur 1974 überhaupt nicht vergeben.
All jene, die mit Thomas Pynchons Romanen nie warm werden konnten, haben jetzt immerhin die Chance, eines seiner Werke im Kino zu entdecken: Seit zwei Wochen läuft dort „One Battle After Another“, ein Film von Paul Thomas Anderson. Anderson ist bekennender Pynchon-Fan: Wenn ein neues Buch des Meisters erscheint, schließt er sich damit in seinem Zimmer ein und hängt ein „Bitte nicht stören”-Schild an die Klinke. „One Battle After Another“ basiert weitläufig auf Thomas Pynchons Roman „Vineland“, allerdings wurde die Handlung aus der Reagan-Ära in die Gegenwart verschoben.
Die unverwüstlichen Anhänger von Thomas Pynchon dürfen sich unterdessen nicht nur über sein neues Buch freuen. Es gibt außerdem Hoffnung, einen Blick in das Gehirn dieses merkwürdigen Schriftstellers zu erhaschen: Thomas Pynchon hat sein Privatarchiv für einen unbekannten Preis an die Huntington Library verkauft, eine Privatbibliothek in Kalifornien. 48 Kisten mit allen Material von den späten Fünfzigerjahren bis circa 2022. Die Manuskripte all seiner großen Romane. Notizen, die Pynchon während seiner ausgedehnten Recherchen gemacht hat. Nur eines, sagen die Bibliothekare, sei auch in jenen 48 Kisten nicht zu finden: ein neues Bild des Autors.
Thomas Pynchons Roman „Shadow Ticket“ ist im amerikanischen Original bei Penguin erschienen (ca. 22 Euro). Die deutsche Übersetzung „Schattennummer“ kommt am 14. Oktober 2025 bei Rowohlt heraus.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.