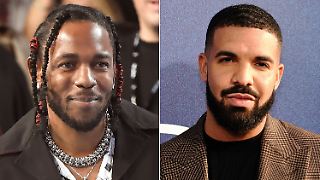Leute, die schon einmal eine Nahtoderfahrung hatten, berichten, sie hätten sich, nachdem sie gestorben waren, in einem Tunnel wiedergefunden, an dessen anderem Ende ein Licht schien. Manche sahen aus der Helligkeit Engel heranschweben, andere wurden von lieben Verstorbenen in Empfang genommen. Zurzeit läuft im Hudson Theatre am Broadway eine Inszenierung von Samuel Becketts Klassiker „Warten auf Godot“, in der Keanu Reeves eine der beiden Hauptrollen spielt (gleich mehr dazu.)
Für diese Inszenierung hat sich Soutra Gilmore ein tolles Bühnenbild ausgedacht: Das Stück findet in einer großen Betonröhre statt, deren Ende schwarz ist – wir haben es also quasi mit der Umkehrung einer Nahtoderfahrung zu tun. Das letzte Stück Leben ist erleuchtet und eingegrenzt; am Ende wartet das Nichts auf uns. Bekanntlich handelt es sich bei „Warten auf Godot“ um ein urkomisches Stück darüber, dass unsere Existenz auf diesem Planeten absurd ist und dass wir sie damit verbringen, auf einen Herrn namens Gott oder so ähnlich zu warten, der durch Abwesenheit glänzt.
Den einen der beiden Landstreicher, die bei Beckett auf den unpünktlichen Herrn Godot warten, spielt am Broadway, wie schon gesagt, Keanu Reeves. Er ist Estragon, jener Vagabund, der sich durch Wehleidigkeit und untergründige Grausamkeit auszeichnet. Sein Widerpart – der ängstliche, mehr praktisch veranlagte Wladimir – wird von dem britischen Schauspieler Alex Winter verkörpert. Das New Yorker Publikum begrüßte die beiden Berühmtheiten mit enthusiastischem Hallo. Der Hollywoodschauspieler hat im Lauf seiner langen Karriere schon Aliens, Dämonen, Racheengel und mystische Helden gegeben. Kann er auch einen Estragon? Keanu Reeves hat sich für seine Rolle einen schönen langen Bart stehen lassen, mit der schwarzen Melone auf dem Kopf sieht er beinahe weise aus.
Als Estragon geht Keanu Reeves ganz aus sich heraus
Menschen, die Keanu Reeves näher kennen, beschreiben ihn als schüchtern, freundlich und hochintelligent. Als Estragon ging er ganz aus sich heraus. Die Inszenierung von Jamie Lloyd setzt sehr auf Klamauk – eine legitime Deutung des Stücks –, und Keanu Reeves und Alex Winter machen jeden erdenklichen Gebrauch von der Betonröhre: Sie strampeln, taumeln, laufen die runden Wände hoch, liegen auf dem Rücken und kommen nicht mehr hoch, helfen einander auf die Beine und fallen dabei hin. In einer Szene verliert Keanu Reeves seine Hosen und steht nur in der Unterhose da; große Begeisterung der weiblichen Fans im Publikum.
Alle Schauspieler tragen Mikrofone. Damit wird immerhin ein Problem umgangen, das häufig herrscht, wenn Hollywoodgrößen am Broadway auftreten: Sie haben nie gelernt, ihre Stimmen zu projizieren, in der Regel versteht man sie schlecht. Und der Klamauk von Keanu Reeves und Alex Winter ist gut einstudiert, er wirkt an keiner Stelle peinlich. Aber kann man guten Gewissens behaupten, dass der Mann aus Hollywood der hellste Stern dieses Theaterabends ist?
Nein. Der Test, ob Wladimir und Estragon ihre Sache gut gemacht haben, kommt immer dann, wenn zwei andere Figuren die Bühne betreten: Pozzo und Lucky, der grausame Sklaventreiber und sein irrer Knecht. Wenn sie mit ihrem Auftritt Wladimir und Estragon in den Schatten stellen, war die schauspielerische Leistung mindestens eines der beiden vorher nicht stark genug. Und in dieser Inszenierung vergisst man Keanu Reeves auf der Stelle, wenn Brandon J. Dirden (Pozzo mit Sonnenbrille) seine imaginäre Peitsche schwingt. Der eigentliche Star aber ist Michael Patrick Thornton, ein Schauspieler, der auch im wahren Leben im Rollstuhl sitzt.
Ein Schlüsselmoment in „Warten auf Godot“ ist gekommen, wenn Pozzo seinem Sklaven Lucky mit harscher Stimme befiehlt zu denken, worauf aus diesem ein dunkler Strom von Wörtern hervorquillt, in denen es irgendwie um Gott, das Universum und den restlichen Mist geht. Meistens wird das so inszeniert, dass Lucky sehr schnell spricht. Hier wurde der umgekehrte Weg gewählt: Alles Scheinwerferlicht bündelt sich auf den Sklaven im Rollstuhl, und Michael Patrick Thornton gibt den sinnfreien Wortschwall so bedächtig von sich, als halte er eine tiefgründige Vorlesung. Langweilig wird das in keinem Moment. Der Jubel, der Keanu Reeves zuteilwurde, als er seine Hosen verlor, hätte eigentlich Thornton wegen dieser schauspielerischen Leistung gebührt.
Es wäre möglich gewesen, „Warten auf Godot“ als zeitkritisches, das heißt: antifaschistisches Stück zu inszenieren. Schließlich geht es bei Samuel Beckett, der die deutsche Besatzung in Frankreich erlebte und für die Résistance tätig war, immer wieder um Folter und Mord. Genaue Leser seines Stücks haben erkannt, dass die Situation, die Beckett beschreibt – zwei Leute warten vergeblich auf einen dritten, einen Kontaktmann – in der Résistance zum Alltag gehörte.
Jamie Lloyd hat sich in seiner Inszenierung entschieden, mehr den theologischen Aspekt zu betonen: Am Ende jedes Aktes schiebt sich eine helle beleuchtete Scheibe vor das Nichts am Ende des Tunnels, aus dem Licht tritt ein Kind (gespielt von Eric Williams) hervor, das verkündet, Godot werde leider nicht kommen; und in seinem weißen Bademantel sieht dieses Kind wie ein Engel aus. Unmöglich, dabei nicht an den Wettbewerb zu denken, den einst eine britische Zeitschrift veranstaltet hat. Sie forderte ihre Leserinnen und Leser auf, sich happy endings für tragische Stücke auszudenken. Den ersten Preis gewann eine Einsendung, die aus genau zwei Worten bestand: „Godot kommt.“
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.