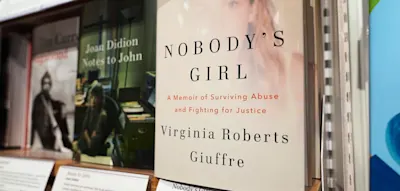Die Verdutztheit, mit der die Kunstwelt auf Robert Rauschenberg reagierte, als er in den 1950er-Jahren in sie hineinplatzte, kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die künstlerische Avantgarde in New York von den „abstrakten Expressionisten“ beherrscht: vor allem Männern wie Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, die mit gefurchten Stirnen ihre Leinwände einschmierten, Farben aus Ölkannen tröpfeln ließen, archaische Figuren hinfetzten und es bei alldem furchtbar, furchtbar ernst meinten. Dann kam plötzlich dieser ungefähr eine Generation jüngere Robert Rauschenberg daher und klebte aus Müll, den er im Süden von Manhattan aufklaubte, seine Kunstwerke zusammen, die allesamt nur eine Botschaft hatten: Das Leben ist schön, und das Dasein ist gut.
Wahrscheinlich konnte jemand, der, wie Robert Rauschenberg, als Spross einer christlich-fundamentalistischen Familie in Texas geboren wurde, mit seinem Partner und Kollegen Cy Twombly in Italien seine Bisexualität ausleben durfte und nebenbei auch noch künstlerischen Erfolg hatte, gar keine andere Botschaft haben als diese. Die Kunsthistoriker haben sich später darauf geeinigt, ihn als „Neo-Dadaisten“ zu bezeichnen. Das trifft es nicht ganz: Robert Rauschenberg war deutlich besser gelaunt als die verzweifelt-absurden Spaßmacher nach dem Ersten Weltkrieg.
Am 22. Oktober 2025 wäre er 100 Jahre alt geworden. Auf der ganzen Welt sind ihm darum Ausstellungen gewidmet, allein in New York sind es vier. Im Stadtmuseum von New York sind Schwarz-Weiß-Fotos von Rauschenberg zu besichtigen: seine Frau Simone Weil vor einem See im Central Park, sein Kollege Jasper Johns, der seelenvoll zur Seite blickt. Vor allem haben es Rauschenberg aber Fassaden angetan: Wie besessen fotografierte er Hauseingänge und Fenster und Gebäude in der damals noch überhaupt nicht schicken Lower East Side.
Das Grey Art Museum erinnert daran, dass Rauschenberg sich sein Leben lang für den Umweltschutz einsetzte: Er fügte Zeitungsartikel zusammen, die von leckgeschlagenen Öltankern berichteten, und klebte das große Foto eines Kalbes auf eines seiner Bilder, das den Betrachter so unschuldig anblickt wie ein kleines Kind. Auch die Galerie „Gemini G.E.L. at Joni Moisant Weyl“ zeigt eine Auswahl von Rauschenbergs Kunst.
Wer die wichtigste Rauschenberg-Ausstellung sehen will, muss aber das Guggenheim Museum aufsuchen. Zwar ist dem Künstler in dem gewaltigen Schneckenhaus an der Fifth Avenue nur ein Raum ganz oben gewidmet; doch dieser eine Raum hat es in sich. Dort wird nämlich ein beinahe zehn Meter langes Monumentalgemälde von Robert Rauschenberg mit dem Titel „Barge“ (Lastkahn) gezeigt, das seit 2001 in New York nicht mehr zu sehen war.
Rauschenberg – der Mann mit dem sonnigen Gemüt
Das Gemälde ist zu groß, als dass man es auf einmal in den Blick fassen könnte. Man muss entlang flanieren und es wie einen Film in sich aufnehmen, der quasi in Schrittgeschwindigkeit vor dem Auge abrollt. Dann sieht man: eine große Mücke mit langen Beinen, Schemen in einem Mietshaus, einen offenen Schirm, der vielleicht vom Wind weggeblasen wird, darunter Footballspieler. Und verschiedene interessante Schlieren, ein Windrad, einen Lastwagen, darunter in sich gekrümmte Autobahnzubringer, die die Rundung des Windrades wiederholen. Am Ende nicht den Schlüssel, den man wahrscheinlich braucht, um die Bedeutung des Ganzen zu verstehen. Das Riesending ist in den Zeitungsfarben weiß, schwarz und silbrig grau gehalten, und je länger man es betrachtet, desto glücklicher wird man. Das Leben ist schön, und das Dasein ist gut.
Natürlich sind in der Ausstellung noch andere Collagen zu sehen: etwa das berühmte karierte Geschirrtuch, das Rauschenberg mit dem Foto einer Faust mit abgespreiztem Daumen bedruckt und mit anderen Fotos umgeben hat. Oder ein übereinander gehängtes Triptychon mit dem Titel „Autobiografie“.
Ganz oben ein Röntgenfoto des Künstlers, umrundet von seinem Geburtshoroskop; darunter ein Foto, das Rauschenberg als Kind bei einer Bootsfahrt mit den Eltern zeigt, drumherum im Kreis lauter Adjektive, die seine künstlerische Laufbahn beschreiben; ganz unten Rauschenberg auf Rollschuhen, der einen runden Fallschirm hinter sich herzieht. Nicht schlecht, aber gegen das schwarz-weiß-silberne Monumentalgemälde kommt all dies nicht an.
Bleibt am Ende die Frage, wie zeitgemäß Robert Rauschenberg – der Mann mit dem sonnigen Gemüt – heute noch ist. Dazu eine Zeitungsmeldung: Als Rauschenberg anno 1970 genug von der New Yorker Kunstszene hatte, siedelte er sich auf Captiva an, einer idyllischen Sanddüneninsel vor der Küste von Florida. Nach seinem Tod sorgte eine Stiftung in Rauschenbergs Namen dafür, dass mehr als 500 Maler, Tänzer und Musiker zeitweise in seiner Villa wohnen durften.
Jetzt will die Stiftung das Anwesen verkaufen. Warum? Der jüngste Hurrikan hat es 2022 buchstäblich plattgemacht, und der steigende Meeresspiegel wird bald ohnehin dazu führen, dass die Sanddüne unter Wasser liegt. Hatten am Ende vielleicht doch die abstrakten Expressionisten mit den gerunzelten Stirnen recht?
„Robert Rauschenberg: Life Can’t Be Stopped“, bis 3. Mai 2026, Guggenheim Museum, New York
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.