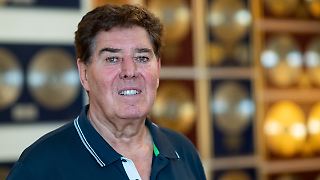Schreitet der Besucher in Michael Maars Berliner Wohnung, gelegen im Hinterhof einer Seitenstraße des Ku’damm, die Regale ab, fühlt er sich, als ginge er in seinem neuen Buch „Das violette Hündchen“ spazieren. Man passiert einen knappen Meter Proust (inklusive Biografien), einen halben Meter Hemingway, begegnet allerlei Graham Greene, sehr viel Nabokov (in der dunkelvioletten Rowohlt-Gesamtausgabe), reichlich Anthony Powell (Geheimtipp!), trifft auf Virginia Woolf, Joyce, Kafka, Thomas Mann, Borges, Colette (unterschätzt!), Mark Twain und Leo Perutz, den Meister des Jüngsten Tages aus Prag. Mit Daniel Kehlmann und seinem fantastischen Roman „Tyll“ holt man, jedenfalls beinahe, die Gegenwart ein. Viel kommt danach nicht mehr.
Maar sitzt auf seinem blumenbekränzten Balkon, eine Weißweinschorle neben den Zigaretten, von denen im Zuge der nächsten Stunden noch einige ihr dicht gestopftes Leben aushauchen werden. Unter den Heutigen tummle er sich „nicht so wahnsinnig“, gesteht Maar. Dafür sei er seit mindestens 30 Jahren einfach zu beschäftigt, aus den Meisterwerken der klassischen Moderne funkelnde Essays zu destillieren.
Maar widmete sich „Proust Pharao“ (2009) mit der gleichen Akribie wie Harry Potter (2002 und 2008), sinnierte über „Große Tagebücher“ (2013), entdeckte 2005 spektakulär das deutsche Urbild von „Lolita“ und widmete der schönen, bösen Welt des Vladimir Nabokov zwei Jahre später ein ganzes Buch, „Solus Rex“. Der einsame König – ein hübsches Vexierbild, in dem ein berühmtes Schachproblem und die Ausnahmestellung des hoffärtigen Literaturgenies zusammenfallen.
Ein paar lebende Lieblinge habe er natürlich schon, sagt Maar, Jochen Schmidt, Max Goldt oder Clemens Setz etwa – feine Stilisten mit großem komischem Talent, hierzulande nicht gerade an jeder Ecke zu haben. Schmidts neuen Roman „Hoplopoiia“, erklärt Maar, längst auch Archivar in eigener Sache, habe er kürzlich für die „Süddeutsche“ rezensiert. Und soeben einen Text über Künstliche Intelligenz und Literatur abgeschlossen. Ein Freund habe angeregt, sich damit für einen Essay-Preis zu bewerben. Der Anlass sei aber zweitrangig gewesen: „Ich habe es geschrieben, weil es mich wirklich interessiert.“
Zu Recherchezwecken habe er ChatGPT gebeten, ein Dramolett im Stil von Max Goldt zu schreiben: „Das war leider nicht schlecht, muss ich zugeben.“ An einer Parodie des Stils von Heinrich Mann sei die Maschine dann aber kläglich gescheitert. Ihr fehle, so Maars vorläufig optimistisches Fazit, einfach das menschliche Fingerspitzengefühl – wie der Bot auch wörtlich zugab.
Damit sind wir beim Thema. Vor fünf Jahren erschien die sensationelle (und sensationell erfolgreiche) Stilfibel „Die Schlange im Wolfspelz“, im Untertitel „Das Geheimnis großer Literatur“. Entlang einer essayistischen Perlenschnur hangelte sich Maar darin durch alles, was in der heimischen Literatur Rang und Namen hat – wobei einige Ränge und Namen eher aus anderen Zusammenhängen bekannt waren. Hildegard Knef etwa hatte man zuvor nicht unbedingt als Schriftstellerin auf dem Zettel, die in einem Atemzug mit Goethe, Keller, Kleist, Rahel Varnhagen und Döblin genannt werden könnte. Und doch widmete Maar ihr bewundernde Zeilen. Auch der früh verstorbene Wolfgang Herrndorf („Tschick“) bekam ein liebevolles Denkmal gesetzt.
Der vornehmliche Aspekt, unter dem Maar seine erzählerischen TÜV-Prüfungen vornimmt, ist der Stil. Egal, ob umschweifend barock oder minimalistisch schlicht – funkeln und singen muss es, wenn Auge und Ohr des Kenners ein Buch aufschlagen, lesend den Text abstauben und seine Musik sozusagen in der inneren Stereoanlage erklingen lassen.
Auch das neue Buch, das nach der Deutschlandreise nun in die Weltliteratur ausgreift, kann und will diese Vorliebe nicht verhehlen. Es geht dezidiert nicht um große Theorien. Es wird kein poststrukturalistischer Phallozentrismus nachgewiesen, psychologische Erörterungen beschränken sich auf alles, was in Charlottenburger Küchen handelsüblich ist, und kommen ohne diffizile Unterscheidungen zwischen Lacan und Jung aus. Metaphern werden nicht als Selbstzweck analysiert, sondern nur da, wo es dem tieferen Verständnis dient. Und das heißt bei Maar immer: Verschränkung von Leben und Werk, Erläuterung des einen aus dem anderen und umgekehrt. Er ist, wie alle eingefleischten Leser, die keine akademischen Auflagen zu erfüllen haben, sozusagen automatisch überzeugt, dass Literatur eine Art Maschine ist, in der sich der Mensch über sich selbst vergewissert. Das muss gar nicht mehr bewiesen werden; das ist eine selbstverständliche Erkenntnisfrucht aus Jahrzehnten Lektüre.
Nur zeigen sollte man es ruhig – sofern man es kann. Zum, wie Goethe sagen würde, „Ergetzen“ all jener, die heute und in Zukunft auf den Pfaden tappen, die die große Literatur (und die von ca. 1850 bis ca. 1950 war wohl nun einmal die größte) ihnen vorgebahnt hat. Dass es hoffentlich nicht weniger werden, dass immer mehr von jenen Teenagern, die zurzeit Dark-Romance-Schmöker verschlingen, immerhin aufwendig ausgestattet mit Fadenheftung und Farbschnitt, rübermachen ins nächste Level der Literatur – nicht zuletzt dafür gibt es auch „Das violette Hündchen“. Und war nicht Bram Stokers „Dracula“, dem ein ganzes Kapitel gewidmet ist, schlicht der erste Bestseller im Bereich Adult Fantasy?
„Details sind die Primzahlen der Prosa“
Den antisemitischen Elementen in dem berühmten Roman, der hinter den vielen Verfilmungen womöglich etwas verschwunden ist, spürt Maar anhand eines einzigen unscheinbaren Verbs nach: „wandern“. Es entlarvt den ruhelosen Vampir als Gevatter des ewigen Juden Ahasver. Den Londoner Literatenzirkel jener Zeit, in der der Roman entstand, beschreibt Maar auf eine Weise, in der stets das eine Detail das andere beleuchtet: „Bram Stoker war mit Oscar Wilde befreundet, mit dem er eine Weile um dieselbe Frau geworben hatte und dessen ‚Bildnis des Dorian Gray‘ atmosphärisch durch den Roman vom auffällig jung bleibenden Grafen spukt. Er war auch befreundet mit Arthur Conan Doyle. Was wiederum den Fahndungsdruck auf Dracula deutlich erhöht.“
So verbinden Themen und Verfahren die Bücher. Sie sprechen ohnehin miteinander. Maar hält ihnen das Mikrofon hin, damit es jeder hören kann.
„Details sind die Primzahlen der Prosa“, steht ganz am Anfang, ein kleines Credo, auf das sich alle folgende Arithmetik stützt. Und Details heißen für Maar: scheinbar unwichtige Nebensachen, die den Fortgang der Handlung kaum oder gar nicht befördern müssen, zugleich aber kleine Kristalle sind, in denen sich das Werk spiegelt. Die drei Blutstropfen im Schnee bei „Parzival“, das Hündchen, das durch Tolstois „Krieg und Frieden“ tollt und markerschütternd bellt, wenn mitleidlose Schüsse sein Herrchen hinstrecken. Der flüchtige Leser bekommt davon so wenig mit wie Tolstois Hauptfigur Pierre, auch er mit den Gedanken woanders. Und doch steht alles da, für den, der genau hinschaut, genau mitspürt.
Details haben einen weiteren Vorteil: Sie sind anschaulich und machen Spaß. Es ist schön zu wissen, an welchem Apfel Lolita knabbert, während sie, auf seinem Schoß sitzend, dem Ungeheuer Humbert Humbert zum ersten Orgasmus verhilft – natürlich ein Golden Delicious. Oder dass Patricia Highsmith eine Ausgabe von Henry James’ „Die Gesandten“ in der Bibliothek der zweiten Klasse jenes Dampfers versteckt, mit dem Tom Ripley nach Italien fährt. Der Witz daran: Die Geschichte von „Der talentierte Mr. Ripley“ ist von James mehr oder weniger abgekupfert – bloß ungleich spannender. Der noch perfidere Witz: Ripley kann das Buch nicht lesen, denn er reist erstklassig. Ein kleiner inside joke, ein Seitenhieb, eine Spitzfindigkeit, eines jener Details, die Literatur erst zum Leben erwecken.
Wir sind, ein paar Weißweinschorlen später, inzwischen bei Maars Stammitaliener angekommen. Dafür war kein Dampfer nötig. Wir sind die paar Schritte zu Fuß gegangen. Maar bestellt Carpaccio mit Pilzen, zudem bitte die Spaghetti mit Scampi und Zitrone. Herrlich. Der Berliner Herbsttag funkelt wie ein gelungenes Detail dem Abend entgegen.
Ein bisschen reden wir noch über Michael Maars heute 87-jährigen Vater Paul, auch er kein Unbekannter, Stichwort: „Am Samstag kam das Sams zurück“. Der Sohn, 65 Jahre alt, runzelt die Stirn. Man sieht ihm an, wenn er einen Wunsch freihätte, dann den, die üblichen Fragen ein für alle Mal los zu sein. Wie lebt es sich im Schatten eines solchen Giganten, wenngleich der Kinderliteratur? So oder so ähnlich lauten sie. Die Antwort: Ihm sei das „Violette Hündchen“ gewidmet, „und er hat es verdient. Er hat mich immer unterstützt, wir lektorieren einander und sind uns nie ins Gehege gekommen.“
Nur in Maars Schlafzimmer übrigens, in dem auch der Schreibtisch steht, da wildert der Vater sozusagen in den Gefilden des Sohns. Wir haben uns die zarten, dabei sehr amüsanten Zeichnungen von Maar Sr. angesehen – allesamt Geburtstagsgeschenke, eine Galerie seiner literarischen Lieblinge –, ehe wir die Treppe hinabgestiegen sind: Proust, Virginia Woolf und G.K. Chesterton hängen da, elegant hingetuscht. Nabokov trägt einen Schmetterling wie eine Fliege um den Hals. Das nächste Detail, das man nicht missen möchte.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.