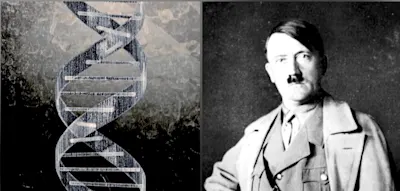Sagen wir es frei heraus: Hermann Göring war der interessanteste Nazi. Hitler – zu pathologisch. Goebbels – zu fanatisch. Himmler und Heydrich – zu graumäusig und kaltblütig. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Göring war einer der schlimmsten NS-Verbrecher, ranghöchster überlebender Nationalsozialist, der sich der Anklage im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess nicht vorab durch Selbstmord entzog – der Bestrafung dann aber sehr wohl. Den Nürnberger Prozess, der am 20. November vor 80 Jahren begann, nutzte Göring als letzte Show in eigener Sache.
Die kürzlich erschienene Göring-Biografie des Journalisten Andreas Molitor wird am Anfang und Schluss vom Nürnberger Prozess gerahmt. Das Buch ist bestens lesbar, kompakt und zugleich fundiert gehalten – 330 Seiten plus Fußnoten, über die sich die Historiker beugen können. Wichtigste Erkenntnis: „Das Göring-Bild in der Öffentlichkeit ist geprägt von Klischees – mehr als das jedes anderen führenden Nationalsozialisten.“
Typische Zuschreibungen sind: Lebemann, Leibesfülle, Leutseligkeit. Molitor beobachtet einen geradezu operettenhaft anmutenden Personenkult um Hermann Göring, der mit dessen Fliegerkarriere im Ersten Weltkrieg begann und mehr vermeintliche als tatsächliche Heldentaten umfasst.
In Sachen Größenwahn steht Göring Hitler vor allem beim Kunstsammeln in nichts nach. Wo der „Führer“ sein geplantes Großmuseum in Linz plante, hortete Göring massenweise Raubkunst für seinen privaten Wohnsitz Carinhall (ein Anwesen bei Berlin, benannt nach Görings 1931 verstorbener erster Frau), der zu einer monumentalen Galerie erweitert werden sollte. „Bei Kriegsende umfasst seine Sammlung mindestens 1375 Gemälde, 250 Skulpturen und 108 Wandteppiche.“ Insbesondere im deutsch besetzten Frankreich plünderte Göring jüdische Sammlungen systematisch aus. Cranach hortete er, hatte am Ende 60 Gemälde. Eher banal bleibt Molitors Versuch einer psychologischen Deutung dieser Sammelwut: „Letztlich dient Görings Kunstsammlung – wie auch seine Passion für die Jagd – der Selbstinszenierung.“ Kapitale Geweihe oder Gemälde an der Wand, beide erfüllen für Göring nur einen Zweck: die Darstellung seiner Macht.
Göring als „Nazi No. 2“
Wie mächtig aber war Göring – und wie wurde er zum „Nazi No. 2“, wie die Alliierten seinen Rang gleich hinter Hitler titulierten? Beim Blick auf Görings Laufbahn ist zweierlei interessant. Zum einen gehört er zu Hitlers frühesten Gefährten und nahm bereits am Novemberputsch 1923 in München teil. 1928 tritt die NSDAP erstmals bei Reichstagswahlen an – und erhält bescheidene 2,6 Prozent der Stimmen. Göring geht als einer von reichsweit zwölf NSDAP-Reichstagsabgeordneten nach Berlin. . „Wir kannten damals nur eine Aufgabe, überall und zu jeder Zeit anzugreifen“, so Göring über diese Zeit. „Wie die Hechte im Karpfenteich, so störten wir die satten Parlamentarier in ihrer beschaulichen Ruhe.“
Allerdings war Göring, so Molitor, vor allem außerparlamentarisch aktiv. Er soll „die Partei in der besseren Gesellschaft hoffähig machen – und natürlich Geld heranschaffen“. Etwa „beim erzkonservativen Bürgertum, das dem Kaiser nachtrauert, beim Militär, beim reaktionären Adel und bei den Schlotbaronen. Bei der Großindustrie soll er Ängste vor einem stramm sozialistischen Kurs der Partei zerstreuen; als Offizier aus gutem Hause und hochdekorierte Fliegerikone wiederum kann er sich in hohen Offizierskreisen der Reichswehr ein Entrée verschaffen“. Molitor bringt Görings Job mit Richard Overy auf den Punkt, er sei in diesen Jahren der „PR-Beauftragte für Nationalsozialismus“ gewesen.
PR in eigener Sache macht Hermann Göring später so gut, dass der Vorname Hermann im Dritten Reich zeitweise sogar beliebter wurde als Adolf, diese Aha-Information (aus Götz Aly: „Volkes Stimme“) streut Molitor ganz beiläufig ein. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten war Göring Reichsminister für Luftfahrt, seit 1934 auch Hitlers Nachfolger im Todesfall, zudem NS-Boss für alle Rohstoff- und Wirtschaftsfragen: Die Hermann-Göring-Werke entwickeln sich zu einem Trust, mit dem die NS-Rohstoffwirtschaft auf kostspielige Autarkie getrimmt wurde: Synthetischer Kautschuk und Öl entstanden aus Braunkohle, Stahl wurde aus minderwertigen deutschen Erzen hergestellt.
Im Jahr 1940 wurde für Göring der Titel „Reichsmarschall“ erfunden. Während des Krieges sank Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe rasch in der Gunst Hitlers. In den letzten Tagen des NS-Regimes ließ Hitler Göring sogar verhaften.
Am 7. Mai 1945 kam Göring in amerikanische Gefangenschaft, am 20. November 1945 begann der Prozess vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, wo er am 1. Oktober 1946 zum Tode verurteilt wurde. Göring gefiel nicht, dass er gehängt werden sollte und beging am 15. November 1946 Selbstmord durch Blausäure. „Die Kapsel mit dem Gift“, so Göring gehässig im Abschiedsbrief, „habe ich seit meiner Einlieferung in Gefangenschaft immer bei mir gehabt. … Erschießen hätte ich mich ohne weiteres lassen. Es ist aber nicht möglich, den Deutschen Reichsmarschall durch den Strang zu richten! Ich wähle deshalb die Todesart des großen Hannibal.“ Größenwahn bis in den Tod.
Eine zentrale Rolle spielte Göring bei der Vorbereitung des Holocaust, am 31. Juli 1941 beauftragte er Reinhard Heydrich, „alle erforderlichen Vorbereitungen (…) für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in Europa zu treffen“ und „in Bälde einen Gesamtentwurf (…) zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen“. Ob mit dem Begriff „Endlösung“ zu diesem Zeitpunkt schon ‚Vernichtung‘ (also Genozid) oder ‚nur‘ Enteignung und Abschiebung zu verstehen ist, lässt Molitor unter Verweis auf spezialisierte Zeithistoriker bewusst offen. Sicher ist, dass Göring mit seinem Schreiben entscheidende Weichen für die Wannseekonferenz am Beginn des Jahres 1942 gestellt hat, an der er wiederum selbst nicht teilnimmt. Schon bei einer Besprechung mit hochrangigen NSDAP-Politikern im Dezember 1938 hatte er verlauten lassen: „Ich wollte gern, daß ich mit der ganzen Judenfrage nichts zu tun habe. (…) Ich will meinen Namen sauber halten auch für später.“
Ein eigenes Buchkapitel widmet Molitor Görings Drogenkonsum. Ja, es stimmt, schreibt Molitor, dass Göring nach seiner Verletzung beim Münchner Putsch 1923 und während seiner Genesung in Innsbruck in den 1920er-Jahren schwer morphiumabhängig wurde. Seine schwedische Frau Carin brachte ihn daraufhin in den Entzug. Dass Göring rückfällig wurde, ist für Molitor eine Legende. Es stimme nicht, was der Schriftsteller Norman Ohler in seinem Sachbuch-Bestseller „Der totale Rausch“ über Görings Morphiumtaumel im Zusammenhang mit der Schlacht von Dünkirchen im Mai 1940 fabuliert habe. Görings Selbstüberschätzung, 400.000 alliierte Soldaten mit der Luftwaffe im Alleingang auszuschalten, stehe in keinem belegbaren Zusammenhang mit Morphiumkonsum. Ausführlich und mit allerhand Quellen aus der Göring-Forschung legt Molitor dar, dass Göring in diesen Jahren allenfalls paracodinabhängig war. Doch, so Molitor, das Klischee vom Suchtmenschen Göring passe anscheinend zu gut ins „Bild eines Mannes, der kein Maß kennt“, der „ein selbstverliebter, geltungssüchtiger und übergewichtiger Bonvivant“ war.
Molitor bleibt als Biograf angenehm nüchtern, dabei nicht unbeteiligt, denn gleich zu Anfang schildert er, dass sein Vater Matthias Molitor sich 1943, als 16-jähriger Flakhelfer, freiwillig für die „Division Hermann Göring“ in Rippin (Rypin) gemeldet habe, als Offiziersanwärter zur Luftwaffe. Molitors Großvater mütterlicherseits wiederum, Josef Mundt, sei ein sadistischer „Folterknecht“ der SA im rheinischen Düren gewesen. Die Verstrickung der eigenen Familie gab Molitor den Anlass, sich nach mehreren journalistischen Artikeln nun auch als Biograf mit Hermann Göring auseinanderzusetzen.
Ein besonderes Augenmerk legt Molitor auf Görings wenig ausgeleuchtete Kindheit. Wie sehr sich aber wirklich ein Bogen spannen lässt vom seelisch vernachlässigten Privatschüler bis hin zum kalt-empathielosen Leitwolf der Kriegsverbrecher auf der Nürnberger Anklagebank, muss psychologische Spekulation bleiben. Man liest Molitors Buch gierig und findet Göring faszinierend und abstoßend zugleich. Eine ebenso fesselnde wie unheimliche Biografie.
Andreas Molitor: Hermann Göring. Macht und Exzess. Eine Biografie. C.H. Beck, 411 Seiten, 32 Euro
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.