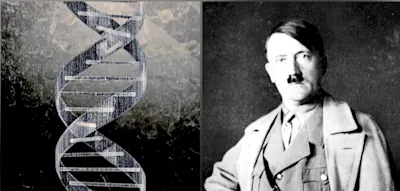Place aux Jeunes!“ (Macht Platz für die Jungen!) stand auf der Visitenkarte von Berthe Weill, die im Jahr 1901 – als erste Frau – eine Avantgardegalerie in Paris gründete. Im Wortspiel ihres Kosenamens „Mère Weill“ klingt bereits das Wunder (merveille) der erstaunlichen Karriere dieser kleinen Person mit großer Brille an, die sich gegen dreifache Schwierigkeiten zu behaupten hatte: als Frau, Jüdin und aus bescheidenen Verhältnissen.
An manchen Tagen hingen die noch feuchten Gemälde an Wäscheleinen quer durch die Galerie, die an ihren vier Standorten bis 1940 fast 140 Ausstellungen zählte. Darunter eine eindrucksvolle Liste an Debüts, die neben heute vergessenen Namen das „Who’s Who“ der frühen Moderne umfasst. Mit der deutschen Besetzung von Paris war Weill jedoch wegen ihrer jüdischen Herkunft gezwungen, ihre Galerie aufzugeben. Bei der Befreiung war die 80-Jährige krank und mittellos. Ihr nahe stehende Künstler und Händler spendeten mehr als achtzig Werke für eine Auktion, aus deren Erlös Berthe Weill bis zu ihrem Lebensende 1951 versorgt war.
Karriereauftakt mit Picasso
Wenige Jahre nach ihrem Tod war eine der großen Galeristinnen des 20. Jahrhunderts vergessen. Bekannt blieben ihre männlichen Kollegen wie Ambroise Vollard und Daniel-Henry Kahnweiler, die mit großzügigen Angeboten Weills Künstler unter Vertrag nahmen. Umso verdienstvoller ist ihre Wiederentdeckung, der das Musée de l’Orangerie eine Schau an ihrem Wirkungsort Paris widmet.
Sie verdankt sich nicht zuletzt Weills Biografin Marianne Le Morvan, die sich bemüht, das Galeriearchiv zu rekonstruieren. In detektivischer Kleinarbeit konnten rund hundert Werke plus Fotos, Dokumente und Publikationen zusammengetragen werden, die jetzt die beeindruckende Geschichte von Berthe Weill erzählen. Ihr Programm, das sie mit einem unverblümt direkten und sarkastischen Galeriejournal begleitete, zielte mitten ins Auge.
1865 als fünftes von sieben Kindern in Paris geboren, fasste sie nach einer soliden Ausbildung im Grafik- und Bilderhandel 1901 den „unumstößlichen Entschluss“, ihren eigenen Galerieraum auf dem Montmartre im Zentrum der Bohème zu eröffnen. Durch den spanischen Kunsthändler Pere Mañach lernte sie den 19-jährigen Pablo Picasso kennen, von dem sie sogleich die ersten drei Bilder erwarb, bevor sie ihm 1902 eine Einzelausstellung widmete.
Damals unverkäufliche Bilder wie „Das blaue Zimmer“ und die „Kurtisane mit dem Perlencollier“ geben einen lebhaften Eindruck von der Armut und Anmut zwischen Bateau-Lavoir und Moulin Rouge. Im selben Jahr präsentierte Weill – ebenfalls als Erste – Werke von Matisse in ihrer Galerie, wo sie bereits 1905 das „Erste Stillleben mit Orangen“ verkaufte.
Als „Notre-Dame des Fauves“ war Berthe Weill eine Vorkämpferin der wilden jungen Maler um Matisse, noch bevor diese beim Herbstsalon 1905 ihren Gruppennamen erhielten. Auch die Kubisten hatten 1913 gerade erst von Apollinaire ihren Namen bekommen, als Weill schon die Bilder von Fernand Léger, Albert Gleizes und Jean Metzinger zeigte. Ein Paradebeispiel für den internationalen Erfolg des Kubismus liefert der schöne „Eiffelturm“ von Diego Rivera, dem sie 1914 die erste Soloschau in Europa widmete.
Der größte Coup aus heutiger Sicht gelang ihr aber 1917 mit der Soloausstellung von Amedeo Modigliani, die den berühmten Schamhaarskandal verursachte. Die durchs Fenster sichtbaren Bilder wie der weibliche „Akt mit Korallenkette“, der die linke Hand ganz ohne Scham in seiner Scham ruhen lässt, hatten die Polizei auf den Plan gerufen. Während Weill keines der liegenden Aktbilder verkaufen konnte, sorgte ein Jahrhundert später ein Gemälde aus dieser Ausstellung erneut für Furore, als es 2018 bei Sotheby’s für 157 Millionen Dollar versteigert wurde.
Idealtypisch lässig
Sie nahmen bereits das Bild der „Neuen Frau“ vorweg, das die Liegende mit Zigarette in Suzanne Valadons „La chambre bleue“ mit selbstbewusster Lässigkeit idealtypisch verkörpert. Die gerade mit einer Retrospektive im Centre Pompidou Geehrte war nicht die einzige der emanzipierten modernen Künstlerinnen, für die sich Weill einsetzte. Enge Freundschaft verband sie mit Émilie Charmy, die ein modernes Porträt ihrer Galeristin von großzügiger Schlichtheit geschaffen hat.
Trotz mancher Freundschaften lehnte Weill die exklusive Vertretung von Künstlern ab, sie hielt sie für unfair. Stattdessen lud sie einmal pro Jahr zu thematischen Gruppenausstellungen ein, um neue Werke akquirieren zu können. So steuerte etwa Raoul Dufy zum 30-jährigen Galeriejubiläum 1931 das rosarote Interieur mit der titelgebenden Bildunterschrift „Trente ans ou la vie en rose“ bei, das sich heute im Musée d’Art Moderne befindet.
Dass der Alltag oftmals alles andere als rosig war, zieht sich wie ein roter Faden durch Weills 1933 erschienene und jetzt neu aufgelegte Autobiografie „Pan! Dans l’œil“. Immer wieder mussten nebenher Bücher und Antiquitäten verkauft werden, um den Fortbestand ihrer Galerie zu sichern. Der unmittelbare Vergleich zu den zahlreichen Hauptwerken der Sammlung ihres Kunsthändlerkollegen Paul Guillaume in der Orangerie zeigt, dass Weill weniger erfolgreiche Händlerin als eine grandiose Entdeckerin war.
Kühne Unternehmerin
Noch Ende der 1930er-Jahre griff sie die neuen Tendenzen der Abstraktion auf und stellte die abstrakten Kompositionen von Otto Freundlich aus, dessen Skulptur zwei Jahre zuvor auf dem Titelblatt des Katalogs der NS-Ausstellung „Entartete Kunst“ prangte. Seit dem Anfang ihrer Karriere hatte sie sich in Bezug auf die Dreyfus-Affäre mutig gegen den virulenten Antisemitismus positioniert, der ihr jetzt offen entgegenschlug.
Die späte Würdigung von Kunsthändlerinnen der Moderne ist nicht nur auffällig, sondern überfällig. Nach Edith Halpert (2019 im Jewish Museum, New York), Grete Ring (2023 in der Berliner Villa Liebermann am Wannsee), Hanna Bekker vom Rath (2024 im Berliner Brücke-Museum und in den Kunstsammlungen Chemnitz) und Galka Scheyer (2024 im Städtischen Museum Braunschweig) gehört auch Berthe Weill in die erste Riege unternehmerischer Frauen der ersten Jahrhunderthälfte, die für die Künstler und Künstlerinnen der eigenen Generation eintraten.
Wie schwer sie es hatten, sich gegen ihre männlichen Kollegen durchzusetzen, lässt sich allein am Namen der Galerie B. Weill ablesen, der ihre weibliche Inhaberschaft verschleierte. Auch im Kosenamen verbirgt sich, genau wie bei der gleichaltrigen Düsseldorfer Galeristin „Mutter Ey“, eine bezeichnende Rollenzuschreibung der mütterlichen Protektorin oder Mäzenin, die vor der Unternehmerin kommt.
So mündet die Ausstellung mit einer vielsagenden Pointe: In der witzigen Serie von 56 Karikaturen, die César Abin 1932 den Künstlern, Kritikern und Händlern seiner Zeit zumeist in Einzeldarstellungen gewidmet hat, ist Berthe Weill nicht nur die einzige Frau, sondern wird auch als einzige im Kreis ihrer Künstler als „jüdische Mutter“ karikiert.
„Berthe Weill, Galeriste d’avant-garde“, bis zum 26. Januar 2026, Musée de l’Orangerie, Paris (Katalog 39 Euro)
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.