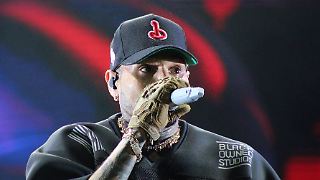Eine gespannte Stille herrscht im Rhypark, einer Event-Location am Rheinufer in Basel, als Attila Bornemisza und seine Schwester Tünde die Bühne betreten. Gemeinsam vertreten die beiden Wiener als Abor & Tynna dieses Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Song „Baller“. Die Sonne scheint, das Setting ist wenig spektakulär: ein Keyboard, drei Flaggen – und eben die beiden. Die deutsche und österreichische Botschaft haben gemeinsam zu einem Empfang zum Eurovision Songcontest eingeladen, der dieses Jahr in der Schweizer Stadt stattfindet.
Doch sobald die ersten Töne aus Abors mit weißen LEDs erleuchteten E-Cello ertönen und Tynna anfängt zu singen, sind alle im Raum in ihren Bann gezogen. Ihre Stimme ist klar, hat einen ganz eigenen Vibe. Die beiden, 24 und 26 Jahre alt, gelten als Hoffnungsträger. Endlich wieder vorne mitspielen beim größten Musikwettbewerb der Welt. Nicht nur ESC-Fans wünschen sich das, sondern auch der NDR. Der Sender hat in seiner Not wieder auf der Höhe der Zeit in Sachen Popmusik sein zu wollen, in diesem Jahr sogar Altmeister Stefan Raab für die Auswahl des deutschen Beitrages miteingespannt.
Noch ein Geschwister-Duo, das Popmusik macht?
Der hat sich den beiden nun angenommen, obwohl eigentlich sorgt er vielmehr für die richtige Portion Aufmerksamkeit. Er betont auf der Bühne beim Botschaftsempfang in Basel, keinerlei künstlerischen Einfluss gehabt zu haben. Er attestiert Abor & Tynna fast etwas Magisches: „Wenn der Song losgeht, reagiert das Publikum sofort.“ Tatsächlich könnte das Event in Basel für die beiden Wiener der Anfang einer großen Karriere sein – das Zeug dazu hätten sie.
Dabei wirken weder Tynna noch Abor wie die geborenen Popstars. Erst wenn sie ihre Songs spielen oder über ihre Musik sinnieren, kommt ein Glitzern zum Vorschein. Kaum zu glauben, dass die beiden, die jetzt in Basel von einem Termin zum anderen hetzen, früher zu den Langweilern gehörten. Sie waren nachts immer früher zu Hause als die anderen, erzählen sie heute. Statt am Handy zu hängen, griffen sie lieber zu klassischen Instrumenten, die immer zu Hause herumstanden.
Kein Wunder, denn ihr Vater, der Cellist Csaba Bornemisza, spielt seit 1993 bei den Wiener Philharmonikern. Klingt nicht gerade nach dem typischen Teenagerleben. Das, was bei ihren Altersgenossen vielleicht seltsam rüberkam, sehen die beiden mittlerweile als Segen. „Das erweitert unseren Horizont und gibt uns die nötigen Werkzeuge, um etwas Tolles zu schaffen“, erklärt Tynna.
Techno-Pop der Gen Z trifft auf Klassik
Die klassischen Wurzeln hört man der Melange aus kühl produziertem Elektro, treibenden Beats und einer Essenz Pop durchaus an. Abor & Tynna produzieren meistens gemeinsam. Musik machen, Songs schreiben, das sei eine intuitive Sache: „Wir lassen uns gerne treiben. Wenn die Vibes stimmen, werfen wir unsere Vorstellungen im Studio problemlos über den Haufen, weil uns viel wichtiger ist, ein gutes Gefühl nicht zu ignorieren, als irgendeine Theorie durchzuziehen.“
Ein Kunststück, das so vielleicht nur Geschwister vollbringen können: „Wir haben ähnliche Einflüsse erfahren und regelmäßig abgecheckt, was der andere für Musik hört und mag.“ Ihre musikalischen Einflüsse tragen eine nostalgische Handschrift: The Weeknd, Lana Del Rey und Billie Eilish, Labyrinth, zählt Tynna auf. „Generell Artists, die vielleicht ein bisschen experimenteller arbeiten, aber den Sound meiner Generation widerspiegeln.“
Wenn es doch mal zu Meinungsverschiedenheiten komme, verzeihe man sich schneller, „da man das von früh an gewohnt ist“, ergänzt Sängerin Tynna. Dennoch fiel ihnen die Arbeit an ihrem Debütalbum „Bittersüß“ nicht leicht: „Dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Songs geschrieben haben, haben wir uns Sorgen gemacht, dass das Album zu bunt wird. Aber es ist für jeden etwas auf dem Album, egal ob alt oder jung, wir haben akustische Songs, elektronische Songs und sogar Hip-Hop.“
Irgendwo zwischen Tarantino und Beziehungs-Nostalgie
Tatsächlich sind viele Stücke geprägt von der titelgebenden Ambivalenz, sie tragen manchmal etwas Sakrales in sich, sie sind fein akzentuiert, wie etwa in Abors Favorit „Katana“, eine Anspielung auf Quentin Tarantinos „Kill Bill“-Reihe. Wie das gleichnamige japanische Schwert wird die Melodie immer wieder durchtrennt, Soundeffekte einer Klinge werden eingeflochten.
Auch textlich ist das, was das Duo auf den 16 Songs abliefert, voller Tiefe. „Wir bauen den Turm von Babel / Aus kalter Liebe und Beton“ heißt es etwa in Tynnas Lieblingsstück „Babylon“. Darin geht um eine Beziehung, die man immer wieder von Neuem aufbauen muss. Vieles wirkt wie ein verklärter, romantisierender Rückblick auf etwas, das mal war – Ex-Beziehungen, Freundschaften, die gehen, jugendliche Naivität.
All das wird zelebriert und lyrisch überhöht, als könne das Morgen nicht besser werden. Ein Einblick in das Seelenleben der Generation Z, die geprägt ist von Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg? „In erster Linie ist es ein persönlicher Charakterzug von mir, dass ich eine gewisse Schwere in mir habe und die Welt oft sehr tief und auf eine Art als sehr schwer wahrnehme. Aber ich glaube schon auch, dass da die Einstellung meiner Generation und die Themen, die meine Generation beschäftigen, eine Rolle spielen“, erklärt Tynna, aus deren Feder die meisten Songs stammen.
Ein bisschen Glitzer-Glitzer
Gleichzeitig schimmern die Songs, man kann den Glitzer in der Produktion quasi greifen, so wie wenn man nach einer Partynacht mit Glitzerkonfetti-Kanone aufwacht und den Glimmer einfach nicht mehr abbekommt. Das spürt man besonders in den hoffnungsvolleren Stücken wie „Tanlines“. Eine eklektische Elektro-Pop-Nummer, in denen das Lyrische-ich nach einer Trennung selbstbewusst neue Wege geht und kokettiert: „Schau, ich hab' jetzt Tan Lines / Du kannst sie nicht berühren, bin nicht mehr deins.“
Eine Facette, die für Sängerin Tynna manchmal eine Herausforderung darstellt: „Das ist mir auch immer wichtig: mich selbst nicht zu ernst zu nehmen und neben der Schwere auch ab und an eine Leichtigkeit reinzubringen.“ Auch ihr ESC-Beitrag „Baller“ schlägt in diese Kerbe ein: Es geht um ein unvermeidbares Beziehungsende, bei dem die zurückgebliebene Partnerin zwar in Erinnerungen schwelgt, aber auf Neuanfang aus ist und sich einen Hauch Rachefeldzug nicht nehmen lassen will.
Ein Pop-Song als Revenge-Porn
Das Lied hat eine radikale, brachiale Wortwahl. Wenngleich das Verb „ballern“ in der deutschen Jugendsprache viele Bedeutungen hat (Drogen nehmen, sich besaufen), wird auch im Song metaphorisch die ursprüngliche Semantik aufgegriffen: etwas abschießen. Das hat im Netz für Kontroversen gesorgt. Einige fanden einen Song, der zum Abknallen mit einer Pistole aufruft, sei fehl am Platz bei einer Veranstaltung wie den ESC, die für Frieden und Toleranz steht.
Statt Manifestation zum Titelgewinn wird gemeckert. Das könnte an der Tatsache liegen, dass nach Jahren, in denen es hieß: „Germany, zero points!“, das kollektive Selbstbewusstsein im Keller ist. Dazu meint Cellist Abor schmunzelnd: „Wir hoffen nach dem ESC am 17. Mai werden sich die Gemüter beruhigen und die Traumata verarbeitet.“ Um ein Haar wäre „Baller“ auch nie beim ESC gelandet. „Wir wollten einen neuen Song schreiben. Einen englischen internationalen Song“, sagt Abor. Stefan Raab habe durch Zufall den Song auf Social Media entdeckt und die beiden überzeugt, dass der Song aufgrund seines Wiedererkennungswertes die bessere Wahl sei.
Die richtige Zeit für ein Deutsch-Pop-Revival?
Mit ihren rumänisch-ungarischen Wurzeln passt das österreichische Geschwister-Duo, das für Deutschland an den Start geht, hervorragend zu dem Event, das oft als Spaß-Spektakel belächelt wird. Dabei steht es für sehr viel mehr – nicht nur für die queere Community, sondern auch in Sachen Völkerverständigung. Bei keiner anderen Veranstaltung hört man so viel Popmusik in für deutsche Ohren doch ungewohnten Sprachen: Kroatisch, Maltesisch oder Isländisch.
Doch für die eigene Sprache scheinen sich deutsche Liedermacher zu schämen: „Baller“ ist der erste Beitrag seit 18 Jahren in deutscher Sprache. Songschreiberin Tynna glaubt, dass das daran liegen könne, dass der ESC ein internationales Event ist und englischsprachige Lieder für das mehrsprachige Publikum zugänglicher sind. „Das kann man auch durch Melodie und Rhythmus schaffen, aber es ist definitiv schwieriger.“ Generell texte sie am liebsten auf Deutsch: „Auf Deutsch haben wir einen größeren Wortschatz, wodurch die Texte persönlicher und intimer werden können.“
Ob die beiden es tatsächlich schaffen, dass die Deutschen wieder wohlwollender auf den Eurovision Song Contest blicken werden, wird sich beim Finale am 17. Mai in der Basler St.-Jakobs-Halle zeigen. Vielleicht wird es fast schon wie in einer selbsterfüllenden Prophezeiung, welche die beiden in einem ihrer Songs aufstellen: „Ich weiß, du hast nicht alle meine Songs gehasst / (...) / Vielleicht hörst du dir ja meine Lieder irgendwann an.“
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.