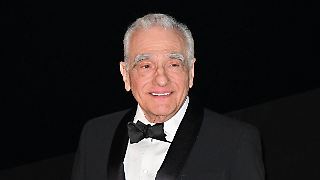An einem sehr heißen Dienstag Anfang Juli hatte ich die dumme Idee, die 13. Berlin Biennale zu besuchen. Dumm auch deshalb, weil das KW Institute for Contemporary Art in der Auguststraße – seit nunmehr 28 Jahren Hauptort der Biennale – wahrscheinlich ebenso lange immer dienstags geschlossen war und, wie ich nun feststellte, auch während der Biennale dienstags geschlossen bleibt. Glücklicherweise war das Büro besetzt, und nachdem meine Begleiterin und ich uns vorgestellt hatten, wurde die Ausstellung tatsächlich nur für uns geöffnet.
Zwei junge Mitarbeiterinnen aus der Kommunikations- und Vermittlungsabteilung begleiteten uns, um auf ihre persönlichen Lieblingsarbeiten hinzuweisen, und auch, wie eine der beiden scherzhaft sagte, „damit ihr nichts klaut“ – was insofern wirklich lustig war, als dass ich in den großen und kleinen Gemäldesammlungen dieser Welt oft über Diebstahl nachdenke, auf politischen Biennalen hingegen nie.
Gleich zu Beginn, wir hatten noch nicht das Remake eines überdimensionierten BHs des argentinischen Feministinnen-Kollektivs Las Chicas del Chancho y el Corpiño gesehen, mit dessen Original, wie der Wandtext uns erklärte, 1995 gegen einen „maskulinistischen Provinzgouverneur“ demonstriert worden war, wir hatten noch kaum etwas über die vielfältigen Protestformen gegen die Diktatur in Myanmar gelernt und ahnten noch nicht, dass wir später selbst demonstrieren würden, in einer interaktiven Videoinstallation und ausgerechnet gegen Elon Musks Pläne zur Mars-Besiedlung – gleich zu Beginn also legte man uns nahe, unbedingt in den Garten hinter dem Hauptausstellungsraum zu gehen, um die dortige Installation der burmesischen Künstlerin Nge Nom nicht zu verpassen.
Berlin Biennale: „Sie knien in einem Kunstwerk!“
Draußen sahen wir einen Mann, der in einem Graben kniete und auf einen Steinblock einhämmerte. So beeindruckt wie ratlos standen wir in der sengenden Hitze – beeindruckt, dass man in so kurzer Zeit nicht nur die Video- und Sound-Arbeiten für uns „hochgefahren“, sondern auch einen Performer in den Graben beordert hatte; ratlos, weil wir den am Garteneingang hängenden Erklärungstext übersehen und unsere Vermittlerinnen diese ihre Lieblingsarbeit vielleicht schon zu oft gesehen hatten, um uns auch hier, bei 35 Grad, noch erklärend zur Seite zu stehen.
Gerade als wir wieder hineingehen wollten, schauten sie durch die Tür, sahen den Mann und steuerten zu unserer Überraschung direkt auf ihn zu. „Entschuldigen Sie“, sagte die eine, „aber Sie knien in einem Kunstwerk.“ Der Mann ließ den Hammer sinken und schaute sich um. „Haben sie denn das Schild nicht gelesen? Da steht doch: Achtung Graben, bitte nicht betreten.“
Der Mann erwiderte, er habe das Schild nicht genau gelesen und gedacht, es würde einen nur warnen, nicht in den Graben zu fallen. „Das auch“, sagte die Frau. Der Mann, der sich nun als Handwerker entpuppte, der im Innenraum eine Steintreppe reparierte und dabei keinen Dreck machen wollte, entschuldigte sich und kletterte aus dem Kunstwerk, welches, wie wir nun erfuhren, an die Flucht der Künstlerin vor der burmesischen Militärpolizei erinnerte.
Nach einer Demonstration im Jahre 2021 waren sie und ihre Freunde durch die Straßen von Rangun gejagt worden und hatten sich über den Zaun in den Garten eines älteren Paares gerettet. Dieses Paar habe ihnen einen Graben am anderen Ende ihres Grundstückes gezeigt, durch den sie – dann endgültig – vor der Polizei in eine andere Gasse fliehen konnten.
Besagter Graben war jetzt wieder leer und die Vermittlerinnen nickten betroffen ob ihrer eigenen Vermittlung. Vielleicht war es die Sonne, vielleicht eine einsetzende Dehydrierung, vielleicht nur der ungläubige Blick des Handwerkers, der sich den Staub abklopfte, bevor er wieder in der Ausstellungshalle verschwand – plötzlich erschien mir der Graben nicht mehr als Platzhalter eines fernen Aufstandes oder als Aufhänger generischer Betroffenheitstexte, sondern als Symbol für die Kunstwelt an sich.
Wann genau hatte das Gutgemeinte das Gute ersetzt? Wer hatte den Graben gegraben, in den Künstler, Kritiker, Kuratoren, Kulturpolitiker, Professoren und ihre Schüler, in den wir letztlich alle reingestiegen, reingefallen, reingeströmt waren? Wann und warum wurden „politische“ Kunstvermeidungs-Ausstellungen wie die 13. Berlin Biennale mit Steuermillionen subventionierte Norm? Eine Norm, gegen die es doch eigentlich, sosehr die Sonne auch brennen mochte, entschieden zu protestieren galt, nicht 1995 in Argentinien, nicht 2021 in Myanmar – sondern 2025 in Deutschland.
Um zu verstehen, wie der deutsche Kunstbetrieb im Graben gelandet ist, muss man kurz zurück auf Los – an denselben Ort an dem ich an besagtem heißen Juli-Dienstag stand, und der Mitte der 1990er-Jahre noch Kunst-Werke heißt. Man muss zurück zu Klaus Biesenbach, einem charismatischen Medizinstudenten, der in diesem besetzen Haus in Berlin-Mitte Ausstellungen, Ateliers und Clubnächte zu organisieren beginnt und so einen Anlaufpunkt für alle nach Berlin ziehenden Künstler schafft, der ähnlich wichtig für den Arm-aber-Sexy-Mythos der Stadt werden soll, wie die Love-Parade und später das Berghain.
Man kann Klaus Biesenbach dafür kritisieren, was er seit 2022 aus der Neuen Nationalgalerie macht – damals, 25 Jahre zuvor, hat er eine Vision, die klarer nicht sein könnte: Eine Biennale muss her. Sie soll zum internationalen Schaufenster des Berliner Booms werden, soll den Gospel der neuen Künstler-Hauptstadt so lautstark verkünden, dass es auch in den letzten Winkeln der damals noch nicht ganz so globalisierten Kunstwelt vernommen würde.
Der Plan geht auf: Die erste Berlin Biennale findet 1998 statt, und ihre Künstlerliste liest sich noch heute fließend. Ólafur Elíasson, Douglas Gordon, John Bock, Monica Bonvicini, Carsten Höller, Rineke Dijksta, Thomas Demand, Dominique Gonzalez-Foerster, Jonathan Meese, Wolfgang Tillmans und Felix Gonzalez-Torres – es sind Namen, die die 2000er-Jahre definieren werden. Und auch Biesenbach selbst und seine Co-Kuratoren Hans-Ulrich Obrist und Nancy Spector werden zu Stars.
So groß ist die Aufbruchsstimmung, dass sie noch ein Jahrzehnt lang anhalten wird. Mit Massimiliano Gioni, Maurizio Cattelan, Elena Filipovic und Adam Szymczyk findet die Berlin Biennale weiter prominente Kuratoren, die sich an Biesenbachs frühem Credo orientieren, die internationale Berliner Szene genauso im Blick behalten zu wollen wie globale Trends. Kai Althoff, Paweł Althamer, Berlinde De Bruyckere, Thomas Schütte, Nairy Baghramian – die Liste der wichtigen Künstler, die hier auf Einladung seiner Nachfolger hin entscheidende Auftritte hatten, sie würde den Rahmen dieses Textes sprengen.
Was aber erzählt uns die 13. Berlin Biennale?
Würde man Biesenbachs Anspruch der Anfangstage auf die von der Inderin Zasha Colah und ihrer argentinischen Kollegin Valentina Viviani kuratierten und „das flüchtige weitergeben“ betitelte Ausstellung anwenden, so wäre die gerade aufregendste in Berlin entstehende Kunst wahrscheinlich eine Hörspieldokumentation von Merle Kröger, die den Suizid eines von Abschiebung bedrohten kurdischen Studenten rekonstruiert.
Globale Trends ließen sich dann zwei ableiten. Grob gesagt beschäftigt sich die eine Hälfte der mehrheitlich aus dem „Globalen Süden“ stammenden internationalen Künstler damit, Artefakte und Erinnerungen ihrer vergangenen Proteste gegen diverse Unrechtssysteme zu sammeln und auszustellen, während die andere Hälfte in Koch-Tutorials, auf bestickten Küchenhandtüchern oder gleich in trockenen Archiv-Installationen die traumatischen Kolonialgeschichten ihrer Herkunftsländer aufarbeiten.
Alle diese Geschichten sind es wert, erzählt und gehört zu werden, nur ist eine Kunstausstellung das denkbar undankbare Medium dafür. Das Hörspiel über den Suizid des kurdischen Studenten hätte man gern um Mitternacht im Deutschlandfunk gehört, von Anfang an am besten und nicht als Schleife auf Türkisch, weil der eine Kopfhörer mit der deutschen Version gerade besetzt ist. Der Video-Essay des kasachischen Kunst- und Forschungskollektivs Artcom Platform über den schleichenden Tod des Balchaschsees – präsentiert in einer „Struktur aus Steppenschilf“ – hätte die Grundlage für eine Arte-Dokumentation liefern können, wäre er nicht mit der Stimme des Sees erzählt.
Und auch die Recherchen von Sinthujan Varatharajah und Moshtari Hilal zu den Nachwirkungen englischer Kolonialgesetzgebung in Kenia, Sri Lanka und Malawi – symbolisiert durch das fortgesetzte Tragen weißer Perücken der dortigen Richter – wäre als gut edierte Reportage in „Le Monde diplomatique“ sicherlich effektvoller gewesen. Hier, im zweiten großen Spielort der Berlin Biennale, einem ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße, sind sie in einer Reihe von Aktenordnern abgelegt, neben der – Sie ahnen es vielleicht – eine weiße Richter-Perücke hängt.
So mag die 13. Ausgabe der Berlin Biennale wie angekündigt von „Widerstand, Justizwillkür und Ökozid berichten“, ihre Meta-Erzählung ist die ihres eigenen Niedergangs, eines angekündigten und trotzdem qualvoll anzusehenden Erstickungstodes der Ästhetik zu Händen der Moral. Aus einem Schaufenster für die Kunstszene in Deutschland ist ein Schaufenster für politische und gesellschaftliche Krisen im Ausland geworden.
Die Mentalität des Sekundären
Der Literaturwissenschaftler George Steiner war es, der in seinem Buch „Von realer Gegenwart“ die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als kritisch-soziales Zeitalter beschrieb, welches auf ein schöpferisches zurückblicke. Für Steiner war der Genius der Nachkriegszeit der Journalismus, nicht mehr als Quelle der Information, sondern wie Botho Strauß es in seinem Nachwort zusammenfasste: „vielmehr als eine umfassende Mentalität des Sekundären, die tief eingedrungen ist in die Literatur, in die Gelehrsamkeit, die Philosophie und nicht zuletzt in den Glauben und seine Ämter.“ Die Kunst der Biennale wird durch die Mentalität des Sekundären nicht nur durchdrungen, sie wird durch sie ersetzt. Der Bericht über die Ungerechtigkeit, die den Künstler inspiriert, ist an die Stelle des durch die Ungerechtigkeit inspirierten Werkes getreten.
Visuell weniger eindrücklich als der Jahresbericht einer mittel-relevanten NGO, muss die 13. Berlin Biennale deshalb – je nach Sichtweise – als Bankrotterklärung eines inzwischen in weiten Teilen kunstfeindlichen Kunstbetriebs gelesen werden oder als arrogante Machtdemonstration desselben. Gerade weil diese Ausstellung kein Einzelfall ist, sondern die Akzeleration eines nach den letzten Documentas und nun bereits vier stramm postkolonialen Berlin Biennalen in Folge klar ablesbaren Trends, lohnt es sich zu fragen, wer hier Macht und wer bloß Ohnmacht demonstriert.
Macht demonstriert vor allem die Politik in Gestalt der Bundeskulturstiftung, die der Berlin Biennale alle zwei Jahre drei Millionen Euro zur Verfügung stellt, der Documenta wie beim letzten Mal gar 27 Millionen. Somit sind Großausstellungen wie „das flüchtige weitergeben“ ebenso politisch gewollt wie eine vergleichbare, immer weiter um sich greifende Programmatik in den Museen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass auch hier die für jede Sonderausstellung dringend benötigten Zusatzgelder vor allem dann fließen, wenn in Förderanträgen Buzzwords wie Inklusion, Barrierefreiheit, Partizipation und Nachhaltigkeit vorkommen sowie im Idealfall versprochen wird, auch queerfeministische und postkoloniale Perspektiven zu berücksichtigen.
Eine neue Generation von Kuratoren, die in den vergangenen Jahren überall Schlüsselstellen besetzt haben – von den führenden Häusern bis in die kleinsten Kunstvereine – muss hier nicht groß erzogen werden. Die meisten von ihnen können sich an Zeiten, in denen Ausstellungen eher ästhetisch als gesellschaftspolitisch begründet wurden, kaum noch erinnern. Und sie haben im Zweifelsfall nicht mehr Kunstgeschichte, sondern Curatorial Studies studiert, wo man derzeit vor allem damit beschäftigt ist, eben jene – natürlich westlich patriarchal denominierte – Kunstgeschichte zu „unlearnen“, wie es in der zunehmend esoterisch werdenden Kuratorensprache heißt.
Die passende Kunst für ihre folgerichtig in „Safe Spaces“ für „kollektives Heilen“ umgewandelten Ausstellungsräume liefern dann junge Künstler, die an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Seminare wie „More than a trigger warning: an introduction to inclusive Art Mediation“ und „Queer Utoping“ belegen, oder an der Berliner Universität der Künste „Postcolonial Identity in Contemporary Art“ studieren und „Unlearning University“-Symposien besuchen.
Das Problem der Findungskommissionen
So ist die 13. Berlin Biennale, ist die Tatsache, dass sie in dieser Form überhaupt stattfinden kann, auch eine Machtdemonstration des akademischen Milieus, welches ihr den intellektuellen Überbau liefert. Derart erfolgreich hat eben jenes Milieu in den vergangenen Jahren Exempel statuiert, Sprechverbote verhängt und Karrieren gecancelt, dass die so entstandene Angst diejenigen zu lähmen scheint, auf deren Einspruch man dringend angewiesen wäre.
Da sind immer wieder die Findungskommissionen, die wie im Falle dieser Berlin Biennale aus etablierten Museumsleitern wie Elena Filipovic und Krist Gruijthuijsen oder Künstlern wie Olaf Nicolai bestehen. Man möchte wirklich nicht Zeuge ihrer bestimmt quälenden Jurysitzungen sein, die immer wieder unter dem Motto „Wie können wir die nächste Großausstellung noch kunstfeindlicher gestalten?“ zu stehen scheinen. Es bleibt unerklärlich, weshalb beispielsweise Filipovic (die in dem von ihr geleiteten Kunstmuseum Basel gerade eine epochale, hinreißende, tatsächlich Augen öffnende Medardo-Rosso-Ausstellung präsentiert) bei einer sich anbahnenden Auswahl der jetzigen Biennale-Kuratorinnen und ihres Konzeptes nicht auf die Barrikaden geht.
Da sind die Journalisten, die wie in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Süddeutschen Zeitung“ und der „ZEIT“ nachzulesen, die 13. Berlin Biennale als „sehenswert“, „horizonterweiternd“ und „facettenreich“ loben. Dass jedoch auf so uninspiriert pflichtschuldige Weise, dass man sicher sein kann: Keiner der Kritiker würde einem nach Berlin reisenden Freund ernsthaft den Besuch der Ausstellung nahelegen. Eher sprechen ihre Lippenbekenntnisse von der Angst durch junge Online-Redakteurinnen, auf deren Wohlwollen man angewiesen ist sowie von den Kunstakademien, an denen man seine Lehraufträge behalten will, nicht als hoffnungslose white old men abgestempelt zu werden.
Und schlussendlich ist da der offensichtlich masochistisch veranlagte Hauptsponsor der Biennale: eigentlich ein klassischer Vertreter des am Ökozid mitschuldigen Petrol-Patriarchats (wie man das in der neuen Kuratorensprache wahrscheinlich formulieren würde) finanziert ausgerechnet Volkswagen die Vermittlungsarbeit und den internationalen Kuratoren-Workshop der Biennale. Als Strafe für derart verzweifeltes virtue signaling muss jetzt die Leiterin des Volkswagen-Kulturengagements in einer Jury 15 „international early career-curators, educators and other practitioners“ auswählen, die auf Kosten von Volkswagen nach Berlin reisen und dort gemeinsam mit den Biennale-Kuratorinnen darüber nachdenken dürfen, „wie kuratorisches Handeln politisch mit der Struktur Ausstellung umgehen kann.“
Die Mächtigen und Ohnmächtigen, die Ideologen und Durchwinker, die Treiber und Mitläufer, letztlich haben sie gemeinsam das Bullshit-Bingo zu verantworten, das aus dem einst visionär gedachten Biennale-Gedanken geworden ist. Statt weiter zu „unlearnen“ und identitätspolitische Reader zu studieren, sollten sie sich in aller Demut daran erinnern, wonach Kunst einmal gestrebt hat – und hoffentlich noch immer strebt.
„Es ist überhaupt keine Frage“, schrieb Botho Strauß schon im Jahr 1993, „dass man glücklich und verzweifelt, ergriffen und erhellt leben kann wie eh und je, freilich nur außerhalb des herrschenden Kulturbegriffs. Was sich stärken muss, ist das Gesonderte. Das Allgemeine ist mächtig und schwächlich zugleich. Der Widerstand ist heute schwerer zu haben, der Konformismus ist intelligent, facettenreich, heimtückischer und gefräßiger als vordem, das Gutgemeinte gemeiner als der offene Blödsinn, gegen den man früher Opposition oder Abkehr zeigte.“
Ob der herrschende Kulturbegriff sich ändern wird, bleibt abzuwarten. Zu tief haben sich die Spuren des Zeitgeists in den Institutionen eingeschrieben, zu radikal haben Sie die Sprechakte geformt, als dass ein Backlash hier zum Befreiungsschlag werden könnte. Simone de Beauvoir wusste, dass Kunst nie bloß moralisches Werkzeug sein, dass sie die Welt erschüttern, nicht bestätigen darf. Wenn wir das Recht auf Unmoral in der Kunst verteidigen und die Ästhetik wieder als „ultima ratio“ setzen, wenn wir das Individuum, das Gesonderte feiern und wieder dem nachspüren, was Immanuel Kant den „metaphysischen Rest“ nannte, dann wäre schon viel gewonnen. Und der Graben im Garten des KW? Über ihn ist schon jetzt Gras gewachsen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.