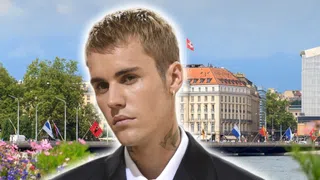Wenn kapitalistische Unternehmen in ihren Werbespots nicht normgerechte Menschen, die man früher als „Freaks“ bezeichnet hätte, präsentieren, wird das als Schritt zu mehr Diversität gefeiert. Mit dem gleichen Enthusiasmus begrüßte es ein Teil des Publikums, dass bei der Eröffnungs-Show der Olympischen Spiele 2024 übergewichtige Transvestiten das letzte Abendmahl parodierten. Aber wenn Menschen mit besonderen äußerlichen Kennzeichen bei der Party zum achtzehnten Geburtstag eines jungen Fußballers als Entertainer auftreten, wird das skandalisiert. Seit zwei Tagen redet die Welt darüber, dass Lamine Yamal für besagte Party kleinwüchsige Darsteller als Ornament engagiert hat.
Ein moralischer Unterschied zwischen dem, was Lamine Yamal getan hat, und dem, was der Autokonzern Jaguar oder der Pariser Regisseur Thomas Jolly getan haben, besteht nicht. Alle drei haben anders aussehende Menschen bezahlt, um deren Schauwert zu nutzen und ihren Shows damit den Anstrich des Besonderen gegeben. In allen drei Fällen versprachen sich auch die engagierten Menschen einen Vorteil davon.
Wie einer der kleinen Darsteller, die für Jamals Party engagiert waren, einem spanischen Radiosender sagte, hätten er und seine Kollegen nicht nur Getränke serviert, getanzt und „Magie gemacht“, sondern auch mitgefeiert und „eine tolle Zeit“ gehabt. „Gedemütigt“ fühlte sich der Darsteller eher von der Präsidentin des spanischen Kleinwüchsigenverbandes, die den Auftritt als „inakzeptabel“ bezeichnet hatte.
Interessant ist in diesem Fall die Frage: Wie kommt überhaupt irgendjemand auf die Idee, Kleinwüchsige könnten als Dekoration für eine Feier eine gute Idee sein? Nun, in keinem Land der Welt liegt dieser Einfall kulturbedingt so nahe wie in Spanien. Zwerge waren lange Statussymbol der spanischen Könige. Berühmt ist Velázquez’ Gemälde „Las Meninas“ aus dem Jahre 1656, das die fünf Jahre alte Königstochter Margarita inmitten von Personen ihres Hofstaats zeigt. Im Vordergrund sieht man zwei kleinwüchsige Personen: die aus Oberösterreich stammende Maria Bárbola und den Italiener Nicolasito Pertusato.
Die Sitte, sich mit sogenannten Hofzwergen zu umgeben, wurde aufgrund der kulturell und machtpolitisch führenden Rolle Spaniens ab dem siebzehnten Jahrhundert zu einer Mode an allen europäischen Höfen – bis hinunter zum letzten deutschen Kleinstaat. Der Publizist Friedrich Carl von Moser berichtet 1762 aus Polen, über das August III., der Sohn August des Starken, herrschte, es habe dort zu Beginn von dessen Regierungszeit noch einen „Grand Maître de la Garderobe“ gegeben, dem unter anderem die „Cammer-Mohren, Zwerge und noch andere Gattungen Cammer-Leute“ unterstanden. Das Wort Zwerg nahm an solchen Höfen geradezu die Bedeutung eines besoldeten Titels an. Für die kleinwüchsigen Menschen, die eine solche Position erreichen konnten, war das ein Privileg.
Heute halten wir diese Praxis für grausam und herzlos. Schon Oscar Wilde hat 1891, inspiriert von Velázquez’ Gemälde, das Märchen „Der Geburtstag der Infantin“ verfasst, in dem er das traurige Schicksal eines solchen Hofzwerges beschreibt. „Infantin“ ist der Titel einer spanischen Königstochter, und eine solche bekommt bei Wilde zu ihrem zwölften Geburtstag einen Zwerg geschenkt – wir bleiben erst einmal bei diesem heute als unpassend angesehenen Wort, weil es Wilde verwendet und weil es den mythologisch-romantischen Aspekt solcher Figuren besser betont als das bürokratische „Kleinwüchsige“.
Der Zwerg in Wildes Märchen hat bis vor Kurzem im Wald gelebt und sich noch nie selbst im Spiegel gesehen. Als die Infantin über ihn lacht, entflammt er in Liebe zu ihr und bildet sich ein, diese würde erwidert. Erst als er zufällig an einem Spiegel vorbeikommt, wird ihm sein eigenes Aussehen bewusst, und er begreift, dass die Infantin und ihre Spielkameraden über ihn lachen. Er stirbt an gebrochenem Herzen. Die Infantin ist empört und befiehlt: „In Zukunft lasst die, die zu mir spielen kommen, keine Herzen haben.“
Die spezielle Rolle, die Zwerge in der spanischen Phantasie spielen, hatte dann auch weitreichende Folgen für die Filmgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Der surrealistische Filmregisseur Luis Buñuel ließ kleine Menschen in seinen Filmen „Nazarín“, „Dieses obskure Objekt der Begierde“ und in „Simon in der Wüste“ auftreten. Sie standen bei ihm stellvertretend für das gesellschaftlich Verdrängte und das Groteske. So ist es auch in Werner Herzogs Film „Auch Zwerge haben klein angefangen“, der – darin eindeutig ein Buñuel-Schüler – die rebellierenden Zöglinge eines Erziehungsheims ausschließlich von Kleinwüchsigen spielen ließ.
Buñuel hat in späten Jahren seine Faszination für Kleinwüchsige eingestanden und sie ironisch unter anderem damit erklärt, er beneide sie um ihre sexuelle Potenz. Das ist ein hartnäckiger Mythos, auf den auch in „Game of Thrones“ angespielt wird. Als Tyrion Lannister in der Serie in die Hände von Sklavenjägern fällt, wollen diese ihn töten und seinen Penis als Wundermittel verkaufen. Doch Tyrion erklärt ihnen, dass ihnen keiner glauben würde, dass es sich um einen Zwergenpenis handelt, denn sein Gemächt sei ganz normal groß. Die Händler beschließen, ihn leben zu lassen, bis sie einen Peniskäufer gefunden haben.
Buñuels Einsatz von Zwergen, um einen wirklichkeitsverzerrenden Effekt zu erzielen, hat zahlreiche Nachahmer gefunden. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sah man oft Zwerge in surrealen Filmsequenzen oder solchen, bei denen nicht klar war, ob es sich um Traum oder Realität handelt. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist die zwergenhafte alte Frau, die 1973 dem von Donald Sutherland gespielten Restaurator am Ende von „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ (Regie: Nicolas Roeg) die Kehle durchschneidet.
Ein letzter Epigone dieser Zwergenmode ist der aufstrebende Jungregisseur Nick Reve (Steve Buscemi) in der Komödie „Living in Oblivion“ aus dem Jahre 1995. Auch er lässt in einer Traumsequenz des Billigfilms, den er unter chaotischen Bedingungen dreht, bedeutungsvoll einen Kleinwüchsigen auftreten. Der Darsteller des Darstellers ist übrigens Peter Dinklage, der dann später auch in „Game of Thrones“ um Penis und Leben bangen musste. Als der kleine Mann und der Regisseur sich zerstreiten, schreit jener dem Spielleiter seine Verachtung für dessen klischeehafte Phantasie entgegen: „Niemand träumt von Zwergen! Noch nicht einmal ich träume von Zwergen!“
Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Lamine Yamal künftig ab und zu von kleinen Menschen träumen wird. Denn so abgebrüht, dass ein Shitstorm, an dem sogar die spanische Regierung beteiligt ist, ihn unberührt lässt, kann ein Teenager gar nicht sein. Zu seiner Verteidigung kann er anführen, dass er immerhin so etwas wie der Infant des spanischen Fußball-Weltreichs ist und sich also nur mit absolut kulturkonformen Insignien geschmückt hat.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.