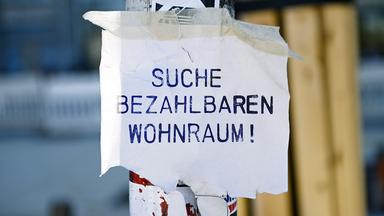Mitten in Chongqing, einer Metropole am Jangtse, befindet sich ein ungewöhnliches Büro. Jeden Morgen erscheinen dort mehrere Dutzend Mitarbeiter in Bürokleidung zur Arbeit – doch ihre Arbeitsplätze sind fiktiv. „Die Computer und Drucker, die Sie hier sehen, sind nicht angeschlossen“, gibt Yulong Liu, der Leiter des Büros, mit einem Lächeln zu. Yulong macht keinen Hehl daraus, dass er mit einem Trugbild handelt.
In seinem „Büro“ können junge Menschen, die seit Monaten vergeblich einen Job suchen, gegen eine geringe Gebühr vorgeben, zur Arbeit zu gehen – und somit ihr Gesicht vor Familie und Freunden wahren. Für einen Tag in einem solchen „Büro“ zahlen die Scheinarbeitnehmer umgerechnet vier bis sieben Dollar. Dabei greifen sie auf ihre Ersparnisse zurück. Denn in der chinesischen Kultur ist das soziale Ansehen viel wert.
Auf den Aufnahmen sehen die Eltern, die wie in China üblich oft Tausende Kilometer entfernt wohnen, wie ihr Kind in einem eleganten Arbeitsumfeld vor dem Computer sitzt. Um ihrem Kind den Aufstieg zu ermöglichen, haben viele Eltern hart gearbeitet. Nun erwarten sie, dass ihre nun erwachsenen Kinder sie im Alter unterstützen.
Ende der 1990er-Jahre erlebte China einen Bildungsaufschwung – heute sind viele junge Hochschulabsolventen arbeitslos. Um im globalen Vergleich aufzuholen, hatte China neue Hochschulen eröffnet und den Bildungsweg an diesen Einrichtungen populär gemacht.
„Eiszeit“ auf dem Arbeitsmarkt
Das Ergebnis: Die Arbeitslosenquote in chinesischen Städten – in den Statistiken werden Städte und Dörfer in China getrennt erfasst – liegt bei über fünf Prozent. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen liegt die Quote sogar bei 17 Prozent, wobei Studenten die Statistik nicht eingeschlossen sind. Chinas Medien sprechen von einer Krise, einer „Eiszeit auf dem Arbeitsmarkt“.
Entsprechend ist die Social-Media-Plattform Xiaohongshu – das chinesische Pendant zu Instagram – voller Anzeigen von Firmen, die solche Scheinarbeitsplätze anbieten. Das Geschäft mit Scheinarbeit boomt: Laut der Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ erreichen einige Beiträge zu diesem Thema eine Reichweite von über 100 Millionen.
Der Grund dafür: Das in der chinesischen Kultur verankerte Ethos von Bildung und Erfolg. Hochschulabsolventen, die keinen Job finden, verstecken sich zu Hause und verfallen in Depressionen. Um diesem Schicksal zu entkommen, suchen andere eine Scheinbeschäftigung und geben damit vor, erfolgreich zu sein. Zu letzteren gehört die 21-jährige Danyi Wu. „Ich habe ein Foto aus dem ‚Büro‘ an meine Familie geschickt“, sagt sie.
Auch der 30-jährige Shui Zhou aus Dongguan, einer Fabrikstadt vor den Toren Hongkongs, verbringt seine Zeit in dem Scheinbüro namens „Pretend to Work“ (zu Deutsch: „Täusche Arbeit vor“). Für ungefähr 4,20 Dollar pro Tag schließt er sich jeden Morgen einer Gruppe von fünf Scheinkollegen an, die wie er Karriereleute spielen. „Ich bin sehr glücklich“, versichert er der BBC. „Es ist, als würden wir in einem Team arbeiten.“
Wie Pilze aus dem Boden schießen ähnliche Phantomunternehmen mit Büroräumen, Computern und Konferenzräumen in Shenzhen, Peking, Shanghai, Chengdu und vielen anderen chinesischen Städten. In Shanghai zum Beispiel hat die 23-jährige Tang Xiaowen ein Foto von sich in einem Scheinbüro an das Dekanat ihrer Hochschule geschickt. Vergangenes Jahr hatte Tang ihr Studium abgeschlossen. Seitdem sucht sie vergeblich nach Arbeit.
Inzwischen gilt an ihrer ehemaligen Hochschule eine ungeschriebene Regel: Absolventen müssen innerhalb eines Jahres eine Betriebszugehörigkeit beweisen, sonst erhalten sie kein Abschlussdiplom. Tang schickte das Foto also an die Hochschule. Im Scheinbüro setzte sie sich an den Schreibtisch und schrieb eine Novelle. In der Hoffnung, sie eines Tages an einen Verlag zu verkaufen.
Schamgefühl durch Arbeitslosigkeit
In den sozialen Medien berichten immer Chinesen, dass sie ihre Arbeitslosigkeit vor der eigenen Familie verheimlichen mussten und teilen ihre Erfahrungen mit dem damit verbundenen Schamgefühl. Ein Beispiel ist Jiawei, der bei einem E-Commerce-Unternehmen im ostchinesischen Hangzhou arbeitete, das insolvent ging.
In der „South China Morning Post“ beschreibt er, wie er seit seiner Entlassung täglich in einem Internetcafé sitzt und Stellenanzeigen durchforstet. Um glaubwürdig als Beschäftigter zu wirken, bleibt er manchmal länger als gewöhnlich im Café und macht damit „Überstunden“.
Feiyu, der Eigentümer von „Pretend to Work“, sagt, er habe selbst Erfahrung mit Arbeitslosigkeit gemacht. Als er zu Beginn der Pandemie sein Geschäft schließen musste, kam er auf die Idee mit dem Scheinbüro. Bereits einen Monat nach der Eröffnung waren alle Plätze an den Schreibtischen belegt.
„Ich verkaufe keine Arbeitsplätze, sondern das Gefühl der Nützlichkeit und – damit einhergehend – der Würde“, erklärt der 30-Jährige der Hongkonger Zeitung. Ganz offen gibt Feiyu zu, dass er nicht weiß, ob sein Geschäft bestehen und weiterhin profitabel bleiben wird. Aktuell bezeichnet er es lieber als „soziales Experiment“.
Dieser Text erschien zuerst bei der polnischen „Gazeta Wyborcza“, wie WELT Mitglied der Leading European Newspaper Alliance (LENA). Übersetzt aus dem Polnischen von Arkadius Jurewicz.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.