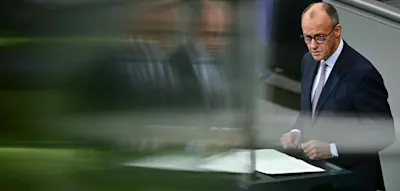Kurz nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis im Jahr 1990 charakterisierte Südafrikas Ikone Nelson Mandela die Außenpolitik seines Landes mit verblüffender Einfachheit. Es sei ein Fehler des Westens, „zu denken, dass ihre Feinde unsere Feinde sein sollten“. Die Haltung seiner Partei, des regierenden African National Congress (ANC), „gegenüber allen Ländern ist bestimmt von der Haltung dieses Landes gegenüber unserem Befreiungskampf“, so Mandela weiter.
Er nutzte seinerzeit jede Gelegenheit, um Diktatoren wie Muammar Gaddafi oder Fidel Castro zu Verfechtern von Menschenrechten zu verklären. Damals gingen derart erstaunliche Töne angesichts der allgemeinen Euphorie nach dem vergleichsweise friedlichen Ende der Apartheid unter, zumal Südafrika eine der liberalsten Verfassungen der Welt verabschiedete. Sonst hätte man womöglich geahnt, dass Mandelas einfache außenpolitische Marschrichtung auch 35 Jahre später noch Bestand haben würde.
Sie ist in der aktuellen Koalitionsregierung weiter fest in ANC-Hand. Das zeigt sich dieser Tage erneut, etwa am Beispiel eines russischen Frachtflugzeugs, das monatelang im Iran stationiert war. Anfang Oktober landete die Iljushin Il-76 der Firma Abakan Air auf dem Flughafen der südafrikanischen Stadt Upington in der Kalahari-Halbwüste – keine 80 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem das Apartheid-Regime einst geheime Atomtests vorbereitete.
Die Maschine steht seit Jahren auf der Sanktionsliste der US-Regierung, weil sie von russischen Staatsunternehmen genutzt wird, die an Waffentransporten beteiligt gewesen sein sollen. Das Flugzeug kam schwer beladen aus Teheran an und startete wenige Stunden später leer zurück in Richtung Russland. Was an Bord war, weiß niemand genau.
Es soll sich um „nicht militärische Fracht“ gehandelt haben – möglicherweise Helikopter oder technische Ausrüstung, heißt es aus Kreisen der südafrikanischen Zivilluftfahrtbehörde. Wieder einmal steht der Verdacht der strategischen Nähe zu Russland und Teheran im Raum. Abakan Air erhielt wenige Wochen vor der Landung eine Sondergenehmigung des südafrikanischen Verkehrsministeriums.
Der Fall erinnert an das ebenfalls sanktionierte russische Frachtschiff „Lady R“, das im Jahr 2022 unter mysteriösen Umständen im Marinestützpunkt Simon’s Town ankerte. Der damalige US-Botschafter behauptete öffentlich, das Boot habe Waffen geladen. Südafrika stritt das vehement ab, eine Untersuchungskommission fand keine Belege für die Vorwürfe. Das bilaterale Verhältnis war da längst zerrüttet – lange vor Donald Trumps zweiter Amtszeit.
Auch ein anderer aktueller Fall bringt die südafrikanische Regierung in Erklärungsnot: In der Ukraine abgeschossene russische Drohnen enthalten offenbar Bauteile aus Südafrika. Nach übereinstimmenden Berichten stammen Laser-Entfernungsmesser aus den Wracks von der Firma Lightware Optoelectronics, die eigentlich Messinstrumente für den Bergbau produziert.
Das Unternehmen bestreitet jede militärische Verwendung seiner Geräte. Wie die Komponenten dennoch in russische Kampfdrohnen gelangten, ist unklar. Möglich ist, dass sie über Zwischenhändler oder Umwege über Drittländer weiterverkauft wurden – ohne Wissen des Herstellers. Die nationale Rüstungskontrollbehörde kündigte jedenfalls eine Untersuchung an, um festzustellen, ob Exportbestimmungen umgangen wurden.
Südafrika hofft im Zollstreit auf Einlenken
Der Zeitpunkt des aktuellen Vorfalls ist allerdings besonders heikel. US-Präsident Trump pflegt bekanntlich eine Privatfehde mit Südafrika. Mehrfach hat er öffentlich gegen das Land ausgeteilt, vor allem zur vermeintlichen Diskriminierung der weißen Minderheit, auf die er mit einem Asylprogramm für weiße Farmer reagierte – und mit 30 Prozent Zöllen auf die meisten Importe aus Südafrika, was Industrie und Arbeitsmarkt empfindlich getroffen hat.
Trotzdem hofft man in Südafrika noch auf ein Einlenken Trumps. Dessen Zoll-Dekrete haben das African Growth and Opportunity Act (AGOA) weitgehend ausgehebelt, das den meisten Ländern Afrikas jahrzehntelang zollfreien Zugang zum US-Markt garantiert hatte. Der südafrikanische Handelsminister Parks Tau zeigte sich zuletzt optimistisch, dass das inzwischen auslaufende AGOA-Abkommen verlängert werden könne.
Im US-Kongress wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der eine zweijährige Verlängerung vorsieht – allerdings unter strengeren Auflagen, etwa zu Menschenrechten und Regierungsführung. Dass ausgerechnet Südafrika diese Auflagen aus Trumps Sicht erfüllt, ist freilich unwahrscheinlich.
In Washington kritisiert man Südafrikas demonstrative Nähe zu Teheran, Moskau und antiwestlichen Bewegungen seit Jahren deutlich offener, als es etwa die EU tut. Besonders die unverhohlenen Hamas-Kontakte der ehemaligen Außenministerin Naledi Pandor stießen in den USA auf Entsetzen.
Sondergesandter wartet auf US-Visum
Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bemüht sich durchaus, die Wogen zu glätten, offenbart dabei aber immer wieder seine Tendenz zu diplomatischen Eigentoren. Im Januar schickte er den impulsiven und moralpredigenden Diplomaten Ebrahim Rasool als neuen Botschafter nach Washington, der Trump nur wenige Wochen später öffentlich beschimpfte: Dieser habe im Wahlkampf eine sogenannte Hundepfeifen-Politik (eng. dog whistling) betrieben, also in seinen Reden codierte Nachrichten versteckt, die nur seine Anhänger verstehen, um „völkische Instinkte“ und eine „weiße Opferrolle“ zu thematisieren. Prompt wurde Rasool zur „Persona non grata“ erklärt und musste das Land verlassen.
Es folgte die Ernennung von Mcebisi Jonas zum Sondergesandten Ramaphosas in die USA, ein Posten, der das Vertrauen wiederherstellen sollte. Doch Jonas ist Vorsitzender des Mobilfunkkonzerns MTN, den die USA verdächtigen, in Afghanistan und im Iran gegen Anti-Terror-Gesetze verstoßen zu haben. Wenig überraschend bekam Jonas bislang kein Visum für die USA – seine erste Dienstreise dorthin steht auch ein halbes Jahr nach seiner Ernennung weiter aus.
Zuletzt rückte auch Russlands Atomkonzern Rosatom erneut ins Blickfeld. Anfang 2025 erklärte Südafrikas Minister für Energie und Mineralressourcen, Gwede Mantashe, man sei bei einem möglichen Bau neuer Atomkraftwerke „für alle wettbewerbsfähigen Anbieter offen“ – ausdrücklich auch für Russland und den Iran.
Zuvor hatte Rosatom sein Interesse am Ausbau der südafrikanischen Kernenergie erneuert. Der Konzern war bereits 2014 unter dem damaligen Präsidenten Jacob Zuma als Favorit für den Bau von acht Reaktoren vorgesehen, bis das völlig überteuerte Projekt auf Drängen des Finanzministeriums gestoppt wurde.
Die nicht nur in den USA bröckelnde internationale Reputation Südafrikas brachte die Denkfabrik Middle East Africa Research Institute (MEARI) neulich treffend auf den Punkt. In einem aktuellen Bericht heißt es: „Südafrika kann nicht beides haben. Man kann nicht zu Hause die Ajatollahs des Iran umarmen und im Westen den roten Teppich erwarten.“
Christian Putsch ist Afrika-Korrespondent. Er hat im Auftrag von WELT seit dem Jahr 2009 aus über 30 Ländern dieses geopolitisch zunehmend bedeutenden Kontinents berichtet.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.