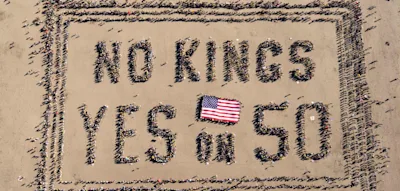Freitagnachmittag in der Bar „K-Fetisch“ in Berlin-Neukölln. Raffaela B. und Abby A. sind nicht zum ersten Mal hier. Sie, Anfang 30, arbeitet im Sozialbereich zum Thema interreligiöse Konflikte. Er, Mitte 30, ist Regisseur und Schauspieler aus Israel. Beide verstehen sich als links – und die Bar beschreibt sich als „linkes trans* und nichtbinäres Kollektiv, das sich für Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Identitäten einsetzt“. B. nennt die Bar einen „safe space“, einen Schutzraum.
An der Theke sei es zu einem Konflikt gekommen, erinnern sich beide im Gespräch mit WELT. B. trägt ein T-Shirt, auf dem das Wort „Falafel“ abgedruckt ist – unter anderem auf Hebräisch und Arabisch. A. und B., die ihren echten Namen nicht veröffentlicht sehen wollen, schildern die Situation wie folgt: Die Barkeeperin habe auf Englisch gefragt, ob die Schriftzeichen auf dem Shirt Hebräisch seien, was B. bejahte. Dann sei die Bar-Beschäftigte aggressiv geworden. Sie bediene keine „Zionisten“. „Sie begann, mich lautstark zu beschimpfen, ich würde einen Völkermord unterstützen“, erzählt B. „Hebräisch sei die Sprache des Unterdrückers; sie würde keine Menschen wie mich in ihrem Café dulden.“
Das Paar habe die Bar, deren Namen man „Kaffeetisch“ ausspricht, dann verlassen – und die Mitarbeiterin habe sie von innen fotografiert, woraufhin es im Innenraum erneut zu einem Dialog gekommen sei. „Die Barkeeperin hat meine Begleiterin angestarrt und angeschrien“, sagt der Israeli A., der seit zwölf Jahren in Berlin lebt. Sie verlangte unsere Namen, um ein Hausverbot zu erteilen, und sagte, wir sollen nie wieder kommen. Kein einziger Gast kam zu uns und hat uns verteidigt.“
Beide bewerten den Vorfall als Antisemitismus. „Sie hat mich als Israeli erkannt, weiß aber sonst nichts über mich“, sagt A. über die Kellnerin. „Das war ganz klar antisemitisch.“ B. sagt: „Wir sagten ihr, das sei antisemitisch, da sie per se die hebräische Sprache ablehnt. Das war wie in den 1930er-Jahren. Die Bedienung wiederholte fortgehend Beleidigungen und rief uns hinterher, wir sollen uns schämen. Die Situation war zutiefst feindselig und einschüchternd.“
Bemerkenswert: Das T-Shirt, an dem sich die Café-Mitarbeiterin gestört haben soll, nennt sich „Falafel Humanity Shirt“ und ist Teil eines Projekts, das sich für Frieden im Nahen Osten einsetzt. „Falafel bringen Menschen zusammen, und so soll das Shirt Solidarität mit allen Menschen in Israel, dem Iran, Palästina und anderen Krisengebieten bekunden“, heißt es auf der Projektseite. Die Gewinne werden an eine Friedensinitiative gespendet, die sich nach eigenen Angaben für eine „gewaltfreie und respektvolle Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts“ engagiert.
Früher ein Treffpunkt für israelfreundliche Linke
Das „K-Fetisch“ war im Jahr 2012 eröffnet worden, damals von einem israelsolidarisch geprägten Kollektiv aus der sogenannten antideutschen Linken. Immer wieder fanden in den ersten Jahren Veranstaltungen statt, in denen über verschiedene Spielarten des Antisemitismus sowie über Islamismus aufgeklärt wurde. In einem Bücherregal stand etwa der autobiografische Roman „1948“, in dem der israelische Schriftsteller Yoram Kaniuk über seine Erlebnisse im Unabhängigkeitskrieg und den Kampf für die Entstehung des Staates Israel schreibt. Die linke Wochenzeitung „Jungle World“, die ebenfalls seit ihrer Gründung Solidarität mit Israel bekundet, führte in dem Café immer wieder Veranstaltungen durch.
Ab dem Jahr 2018 führte die innerlinke Debatte über Israel dann auch im „K-Fetisch“ zu Konflikten. Die linke israelsolidarische Gruppe „Theorie, Kritik & Aktion“ veranstaltete damals in der Bar einen Vortrag der Sozialwissenschaftlerin Tina Sanders über „Elemente des linken Antisemitismus“. Die „Feindschaft gegenüber dem jüdischen Staat Israel“ bilde „oftmals die Basis des heutigen Antisemitismus in der Linken“, hieß es in der Einladung. Die israelfeindliche Gruppe „Jewish Antifa Berlin“, die die Israel-Boykottbewegung BDS unterstützt, intervenierte daraufhin mit einem Statement, in dem der Referentin angebliche „Islamophobie“ vorgeworfen wurde.
„Wir sind uns als Kollektiv in unserer Einschätzung des Vortrags keineswegs einig und haben durchaus unterschiedliche Positionen“, hieß es daraufhin in einem Statement der Bar. Der Vortrag, von dem eine ältere Version bereits auf YouTube zu hören war, sei „stellenweise zu einseitig geraten“. Die mittlerweile aufgelöste militante Stalinistengruppe „Jugendwiderstand“, die immer wieder mit Gewaltbereitschaft und aggressivem Vorgehen gegen proisraelische Linke auffiel, mobilisierte zu der Veranstaltung.
Zum Vortrag drängten sich dann weit über 100 Zuhörer in die Bar. „Schon vor der Veranstaltung hatte sich das Kollektiv teilweise von den Inhalten distanziert“, erinnert sich Tina Sanders im Gespräch mit WELT. „Die Hälfte der Belegschaft weigerte sich damals, an dem Abend zu arbeiten.“ Die Diskussionsrunde eskalierte, Sanders musste durch eine Hintertür aus der Bar begleitet werden. „Das ‚K-Fetisch‘ hat sich im Anschluss nicht gemeldet, um den Vorfall aufzuarbeiten.“
Trotz dieses Vorfalls blieb die Bar damals noch für einige Zeit ein wichtiger Treffpunkt für das israelsolidarische Spektrum innerhalb der Berliner Linken. Um das Jahr 2020 kam es dann zu einem Wechsel des Betreiber-Kollektivs. Dieses ist mittlerweile stark antiimperialistisch und antizionistisch geprägt. Insbesondere seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 fanden im „K-Fetisch“ mehrere israelfeindliche Veranstaltungen statt. Zuletzt postete die Bar am zweiten Jahrestag des Massakers einen Hinweis auf eine Veranstaltung in den eigenen Räumen – für die Unterstützung „politischer Gefangener, die sich gegen das Regime und die Staatsdoktrin Israels und Deutschlands stellen“.
Kurz nach dem 7. Oktober 2023 war das „K-Fetisch“ Ziel antisemitischer Schmierereien geworden. Das Kollektiv veröffentlichte daraufhin in den sozialen Medien eine Erklärung, in der zwar „antisemitische Gewalt in all ihren Formen“ verurteilt wurde, aber gleichzeitig mit Bezug auf proisraelische Linke klargestellt wurde: „Wir sind kein antideutscher Laden.“ In dem Statement hieß es weiter: „Als linkes Café wollen wir vor unserer Community und unseren Nachbar*innen unsere klare Haltung gegen die systematische Ermordung und Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung durch den israelischen Staat ausdrücken.“
Zahlreiche ehemalige Stammgäste und Organisatoren von Veranstaltungen des Cafés wandten sich daraufhin Anfang November 2023 in einem offenen Brief an das Betreiberkollektiv. „Eure Erklärung entsolidarisiert sich mit denen, denen der jüngste Angriff galt“, hieß es darin. „Wir fragen uns: Wie sollen sich Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind oder die von Islamist:innen bedroht werden, im ‚K-Fetisch‘ willkommen fühlen, wenn Ihr im Angesicht eines konkreten antisemitischen Angriffs einen Text verfasst, der vor allem Rassismus sowie die deutsche und die israelische Politik kritisiert und dann in nur zwei knappen allgemeinen Sätzen Antisemitismus verurteilt?“
Und weiter: „Wer einen Völkermord herbeiphantasiert und ‚systematische Ermordung‘ der palästinensischen Bevölkerung behauptet, geht islamistischer Propaganda auf den Leim oder lügt, um Israel zu dämonisieren.“
Das Kollektiv reagierte daraufhin mit einem weiteren Statement. „Wir wollen, dass das ‚K-Fetisch‘ ein Raum ist, in dem sich jüdische Menschen sicher und willkommen fühlen können“, hieß es darin. „Wir befinden uns in einem andauernden Prozess, das ‚K-Fetisch‘ zu einem sichereren Raum für alle marginalisierten und unterdrückten Menschen zu machen.“
Dies ist offensichtlich nicht gelungen, wie der Vorfall am vergangenen Freitag zeigt. „Warum haben auf eurer Regenbogen-Flagge eigentlich alle Platz außer Jüdinnen und Juden?“, fragt Raffaela B. nun an die Bar gerichtet. „Dass es uns durch antisemitische Linke genommen werden soll, uns als politisch links einzuordnen, ist eine Tragödie.“ Abby A. sagt: „Das Kollektiv tritt angeblich gegen Diskriminierung aller Art ein – Diskriminierung gegen Juden betrifft das anscheinend nicht.“ Das Bar-Kollektiv ließ eine Anfrage von Sonntag unbeantwortet.
Politikredakteur Frederik Schindler berichtet für WELT über die AfD, Islamismus, Antisemitismus und Justiz-Themen. Zweiwöchentlich erscheint seine Kolumne „Gegenrede“. Im September erschien im Herder-Verlag sein Buch über den AfD-Politiker Björn Höcke. Einen Auszug können Sie hier lesen, das Vorwort von Robin Alexander hier.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.