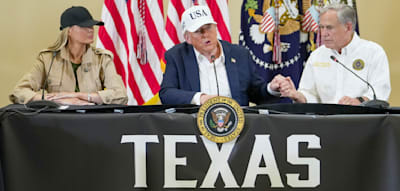Bei jedem Festival gibt es ein „On“ und ein „Off“, einen offiziellen Teil und einen heimlichen. Es ist der französische Google-Chef Benoît Tabaka, der diese Erkenntnis weitergibt. „Der inoffizielle Teil ist in der Regel der interessantere, das ist beim Theaterfestival in Avignon so und das ist auch hier beim Wirtschaftstreffen in Aix-en-Provence nicht anders“, sagt der Mann, der die öffentlichen Angelegenheiten des amerikanischen Tech-Riesen in Frankreich regelt.
Einmal im Jahr versammeln sich bei den „Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence“ drei Tage lang jene, die in Wirtschaftsfragen Rang und Namen haben. Wissenschaftler und Experten aus aller Welt, Politiker, Minister, ehemalige Regierungs- oder Zentralbankchefs versuchen Antworten auf die großen Fragen der Zeit zu geben. „Schock der Realitäten“ war der Titel der 25. Ausgabe am vergangenen Wochenende, die Tausende interessierte Bürger angezogen hat, die bei 38 Grad in Großzelten den Debatten folgten. Aix gilt als das „Davos von Frankreich“, nur ohne Schnee.
Das kalte Wasser floss à volonté, abends auch der Champagner. Da konnte man die Welt durch ein kühles Glas Rosé wie durch eine rosarote Brille betrachten. Doch wer sich am Rande der Rundtische im Schatten hoher Bäume mit den Akteuren der französischen Wirtschaft informell austauschte, muss ein düsteres Fazit ziehen. „Sackgasse“ ist das Wort, das viele benutzten, um die Lage zu beschreiben. Andere diagnostizierten „drei verlorene Jahre“.
Gemeint ist die innenpolitische Lage Frankreichs, die sich erst bei den Präsidentschaftswahlen 2027 ändern kann. Bis dahin ist die Nationalversammlung so gespalten, dass keine größeren Gesetze durchgehen. Die unbeliebte Regierung von Premier François Bayrou könnte jederzeit gestürzt werden. Dafür braucht es nur den Konsens der Extremen, wie sich beim Sturz der letzten Regierung gezeigt hat, als Michel Barnier nach nicht einmal 100 Tagen mit den Stimmen von Links- und Rechtspopulisten abgesägt wurde.
Hinzu kommt die katastrophale Lage der Staatsfinanzen. Wie es um die steht, weiß kaum jemand besser als der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Éric Lombard. „Seit gestern Abend zahlen wir mehr Zinsen als Italien“, warnte er. „Es ist zwingend notwendig, dass wir unser Haushaltsgleichgewicht wiederherstellen.“ Frankreich gebe in diesem Jahr allein 67 Milliarden Euro für Zinszahlung und Schuldentilgung aus, das sei mehr Geld, als irgendeinem Ministerium zur Verfügung stehe. „In drei Jahren werden es 100 Milliarden sein“, prognostizierte Lombard.
Für Investitionen fehlt das Geld
Die Fakten sind erschütternd für ein Land, das zusammen mit Deutschland einst als das Zugpferd der Europäischen Union galt – und heute, in Zeiten von „Trumponomics“, von Regel- und Kontrollverlust, seinen Teil dazu beitragen müsste, Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Doch dabei fällt Frankreich aus, für Investitionen fehlt das Geld. Die Staatsverschuldung hat die symbolische Schwelle von 3000 Milliarden längst überschritten und ist in wenigen Monaten von 113,2 auf 114 Prozent der Wirtschaftsleistung angewachsen.
Am kommenden Dienstag, am Tag nach dem französischen Nationalfeiertag, wenn die Franzosen noch vom Feiern verkatert sind, will Regierungschef Bayrou seinen Vierjahresplan vorstellen. Dessen Ziel ist es, das Defizit von derzeit 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 4,6 im nächsten Jahr zu reduzieren und es 2029 unter drei Prozent zu bringen. Sollte das gelingen, würde Frankreich in vier Jahren wieder den Maastricht-Kriterien entsprechen.
Das war zum letzten Mal vor 17 Jahren der Fall, vor der Finanzkrise 2008. War zuvor von 40 Milliarden Euro die Rede, die Frankreich nächstes Jahr einsparen wolle, raunt man sich nun in Paris zu, dass es 45 Milliarden sein könnten. Steuererhöhungen scheinen hingegen ausgeschlossen. Ein hoher Beamter des Finanzministeriums rechnete beim zweiten Gang des Mittagessens vor, dass man radikal 100 Milliarden Ausgaben streichen müsste. Es gebe genug Spielraum in einem Land, dessen Staatsausgaben 57 Prozent seiner Wirtschaftsleistung ausmachen, zehn Prozent mehr als der europäische Durchschnitt.
Bayrou hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Schuldenberg zu bekämpfen, den „tödlichen Eisberg“ wie er sagt. Er weiß, wie es ausgehen wird. Sein „Kamikaze-Plan“, wie ihn die französischen Medien nennen, wird in der Nationalversammlung aller Voraussicht nach scheitern. Auch wenn alle Fraktionschefs auf die Anstrengung vom Finanzministerium vorbereitet wurden.
Aber was heißt das schon in Zeiten, in denen alle nur an die nächste Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 denken? Spätestens im Herbst könnte der unbeliebte Premier gestürzt werden. „Ich wusste, dass es sich um eine Extremsportart handelt. Aber man muss die Wahrheit sagen. Ich werde den Frieden nicht auf Kosten der Lüge kaufen“, sagte Bayrou dieser Tage.
Für den Pro-Europäer Emmanuel Macron ist Frankreichs Lage eine traurige Bilanz. „Die Wahrheit ist ihm egal. Er hat 1000 Milliarden Schulden gemacht“, heißt es abfällig in Regierungskreisen. Aber er interessiere sich einfach nicht für Defizite.
Bayrou wollte ein Referendum zu den Maastrichtkriterien. Macron lehnte das ab. Vielleicht, weil er das selbst nicht für wichtig hält. Vermutlich aber auch, weil er die Antwort der Franzosen kennt.
Martina Meister berichtet im Auftrag von WELT seit 2015 als freie Korrespondentin in Paris über die französische Politik.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.