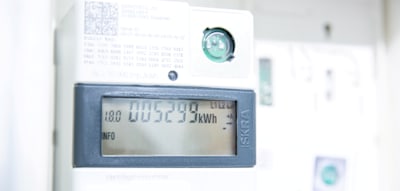Die Wasserstoff-Brennstoffzelle für Fahrzeuge hat sich am Massenmarkt bisher nicht durchsetzen können - obwohl immer wieder neue Modelle und Technologien angekündigt werden. Sie wird deshalb auch als ewige Untote unter den Antriebstechnologien bezeichnet. Stellantis und Daimler Truck haben sich von der Technologie verabschiedet beziehungsweise das Projekt auf die lange Bank geschoben. BMW hält daran fest. Können die Münchener die Wasserstofftechnologie im Alleingang zum Leben erwecken? ntv.de fragt Ferdinand Dudenhöffer. Der Autoexperte sieht in dem Rückzug von Stellantis und Daimler Truck das Ende des Wasserstoffautos in Europa. "Vermutlich wird man auch bei BMW diskutieren, ob sich das Hobby noch lohnt." Ohne China und die USA gehe "die Brennstoffzelle im Pkw ein wie eine Primel", so der Leiter des CAR-Institutes.
ntv.de: Stellantis hat sich von der Brennstoffzelle verabschiedet. Daimler Truck legt Wasserstoff vorerst auf Eis. Nur BMW hält daran fest. Wie angezählt ist die Technologie?
Ferdinand Dudenhöffer: Dass Daimler Truck, der weltgrößte Lkw-Bauer, bei der Wasserstoffmobilität auf die Bremse tritt, ist ein schwerer Schlag. Ab 2027 wollten sie wasserstoffbetriebene Lkws in Serie fertigen. Damit wäre der dringend notwendige Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen in Gang gekommen. Jetzt wurde der Start auf die frühen 2030er Jahre verschoben. Dass man ausgerechnet von Wasserstoff-Lkws, gewissermaßen dem Rettungsanker der Technologie, Abstand nimmt, ist, als würde man das Projekt ad acta legen. Daimler Truck wäre sehr wichtig als Impuls für den Aufbau einer Tankinfrastruktur für Wasserstoff. Dahinter kann man jetzt einen Haken machen. Zusammen mit dem Aus für Wasserstoffantriebe bei Stellantis am Opel-Standort in Rüsselsheim dürfte es das Ende der Brennstoffzelle im Pkw in Europa einläuten.
BMW will trotzdem noch ab 2028 mit Wasserstoffautos in Serienproduktion gehen. Was treibt BMW, mit der Brennstoffzelle ins Risiko zu gehen?
BMW wirbt eben stets mit Technologieoffenheit. Wasserstoff soll der dritte Weg sein. Auch wenn bisher nur sehr wenige Wasserstoffautos produziert werden. Selbst der Toyota-Konzern, von dem BMW die Technik übernommen hat, versucht seit 2005 vergeblich, die Brennstoffzelle mit dem Mirai zu vermarkten. Die Japaner haben in zwanzig Jahren keine 15.000 Wasserstoffautos weltweit gebaut. Das ist ein Nischengeschäft und eine große Serie äußerst unwahrscheinlich. Nach den Nachrichten von Daimler Truck und Stellantis wird vermutlich auch BMW diskutieren, ob sich das Hobby noch lohnt.
In Deutschland gibt es nur rund 100 Wasserstofftankstellen. Einige von ihnen wurden auch schon wieder abgebaut. Ist die fehlende Infrastruktur das größte Problem für die Brennstoffzelle?
Eine Tanksäule, an der nichts mehr verkauft wird, wird abgebaut oder umfunktioniert. Das haben wir schon bei Gastankstellen erlebt. Aber auch Lagerung und Transport sind ein Buch mit sieben Siegeln. Zusätzlich gilt: Der Umwandlungsprozess von Wasserstoff in synthetische Kraftstoffe, sogenannten SynFuels, oder die Nutzung in Brennstoffzellen erfordert viel Energie, die nicht auf die Straße gebracht werden kann. Wasserstoff oder SynFuels mögen für Schiffe, Flugzeuge und bei der Stahlproduktion sinnvoll sein, aber nicht für Pkws oder Lkws. Wir wissen bisher nicht einmal, wo der ganze Wasserstoff herkommen soll. Also die Forderung nach Technologie-Offenheit" bei Autoantrieben ist mehr Wunschdenken als ein tragfähiges Konstrukt.
Wieso prophezeit BMW dann eine "Ära mit erheblicher Nachfrage"?
BMW äußert sich dazu sehr zurückhaltend. Die Rede ist von einer Kleinserie. Wie klein, wissen wir nicht. Und ob sie nach dem Rückzug von Stellantis und Daimler Truck noch kleiner wird, wissen wir auch nicht. Technologieoffenheit bei einer Produktion von 1000 Fahrzeugen pro Jahr bei mehr als zwei Millionen BMW-Pkw jährlich ist nicht der große Wurf. Es wäre wirklich interessant zu wissen, mit wie vielen Wasserstoff-Fahrzeugen BMW-Chef Oliver Zipse in den nächsten drei Jahren rechnet.
Gegenwärtig ist Wasserstoff noch fünfmal teurer als fossile Alternativen. Setzt BMW auf den technologischen Fortschritt?
Im Fall eines technologischen Durchbruchs würde grüner Wasserstoff sicherlich in vielen Bereichen Anwendung finden, aber nicht im Mobilitätsbereich. Die Strategie für den Pkw ist das batterieelektrische Auto. Wasserstoff ist mehr Tagtraum als Realität. Damit die Technologieoffenheit zu untermauern, ist nicht zielführend.
Im Bereich schwerer Nutzfahrzeuge funktioniert die Brennstoffzelle eigentlich gut. Wir sind bei einer Reichweite von 1000 km. 1500 km werden in Aussicht gestellt. Was spricht dagegen, in diesem Bereich weiterzumachen?
Um einen Lkw auf einer Tour von Stockholm nach Sizilien schnell zu betanken, ist Wasserstoff gut geeignet. Das dauert nicht länger als zehn Minuten. Der Haken ist: Es gibt derzeit keinen Wasserstoff zu einem vernünftigen Preis und keiner baut die teuren Tankstellen quer durch Europa. Ein weiterer Grund, warum die Umstellung auf CO2-freie Trucks länger dauern wird, als gedacht, ist, dass Amerika nur noch auf fossile Brennstoffe setzt. Langstrecken-Lkws in Europa sind dadurch nicht mehr spannend genug. Dann sollten wir unsere Waren eher mit der Bahn transportieren.
Es gab in Europa hohe Fördergelder. Die Zulassungszahlen für Wasserstoffautos hat das aber nicht angekurbelt. War das die falsche Förderstrategie?
Nein. Das Wasserstoff- oder Brennstoffzellenauto ist dem batterieelektrischen in allen Bereichen schlicht unterlegen: in technischer Hinsicht, in der Umweltbilanz, Energieeffizienz, bei den Kosten und der Infrastruktur. Selbst mit mehr Fördergeldern würden Brennstoffzellenfahrzeuge hinterherhinken. Die Milliarden fehlgeleiteten Steuergelder an Northvolt und Intel zeigen, dass Fördergelder kein Zaubermittel sind, sondern eher ein Strohfeuer, das falsche Hoffnungen anfacht. Der Markt wird sich immer stärker in Richtung batterieelektrischer Fahrzeuge orientieren. Die Ladezeiten werden kürzer und die dafür nötige Infrastruktur kann sich jeder preisgünstig selbst besorgen. Dazu schrumpft der Preisunterschied zwischen batterieelektrischen und Verbrenner-Pkws. Er liegt mittlerweile bei unter 4000 Euro. Früher waren es 15.000 Euro und mehr. Und noch deutlich vor dem Jahr 2030 wird das batterieelektrische Auto nicht teurer als der Verbrenner sein.
International ergibt sich beim Thema Wasserstoff ein anderes Bild. Während Europa die Projekte zurückfährt, investieren China und die USA weiter …
… aber nicht bei Pkws oder Lkws, sondern in der Stahlproduktion oder beim Strom für riesige KI-Rechenzentren. In den USA gibt es als Lkw-Antriebe nur noch Benzin und Diesel, über synthetische Kraftstoffe oder Brennstoffzellen für Autos und Lkws witzelt Donald Trump. Natürlich geht China in die Wasserstoff-Wirtschaft und investiert. Allerdings nicht bei Pkws oder Lkws. Bei Lkws baut man auf Batterie-Wechselstationen. Die Frage ist nicht, ob man in China und den USA in Wasserstoff investiert oder nicht, sondern macht Wasserstoff für Mobilität Sinn? Die Antwort lautet Nein. Ohne China und USA geht die Brennstoffzelle ein wie eine Primel. Und Japan und Toyota werden das nicht ändern können.
Die Stahl- und Schwerindustrie galten lange als ideale Abnehmer für Wasserstoff. Gilt das immer noch?
Die Stahlindustrie benötigt Wasserstoff, um grünen Stahl zu produzieren, da bei der Stahlproduktion sehr viel CO2 entsteht. Doch auch hier verändert sich was. Salzgitter ist ausgestiegen, Mittal auch. Nur ThyssenKrupp investiert noch im großen Stil. Aber auch hier wird ergebnisoffen diskutiert. Ohne staatliche Unterstützung würde Wasserstoff auch bei Thyssenkrupp auf tönernen Füßen stehen. Wo soll der ganze Wasserstoff herkommen? Fördergelder und Politikerwünsche helfen da nicht.
Wie ist eine solche Fehleinschätzung möglich?
Die Idee war, eine CO2-freie Welt durch so hohe Steuern auf fossile Kraftstoffe zu schaffen, dass andere Kraftstoffe wettbewerbsfähiger werden. Diese Rechnung geht nicht mehr auf, weil die Amerikaner sich nicht mehr für eine CO2-freie oder -neutrale Welt interessieren. "Drill, Baby, Drill" lautet jetzt das Motto. Auch in Europa hat sich was verändert. Man wollte einen Green Deal umsetzen. Doch nicht nur einzelne Länder wie Ungarn sind inzwischen dagegen, auch in Brüssel hat sich die Meinung geändert. Brennstoffzellenfahrzeuge und die Wasserstoff-Wirtschaft scheitern also auch an den nicht eingehaltenen Politikerversprechen.
Die EU verlangt eine schrittweise Dekarbonisierung. Ab 2030 werden die Ziele verschärft. Dann müssen die Autohersteller den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagenflotte um 45 Prozent reduzieren. Vor allem muss der Schwerlastverkehr auf der Fernstrecke dekarbonisiert werden, der aktuell noch vom Diesel dominiert wird. Ist das denn allein mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu schaffen?
Nein, aber Versprechen aus Brüssel sind schon öfter einkassiert worden. Warten wir mal ab, was sich 27 Länder im Bereich Schwerverkehr in fünf oder zehn Jahren überlegen.
Mit Ferdinand Dudenhöffer sprach Diana Dittmer
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.