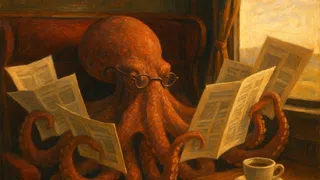Die meisten Menschen schwanken auf merkwürdige Weise zwischen Verleugnung und Akzeptanz des Todes … ich bevorzuge den Kampf.“ Das hat nicht Elias Canetti gesagt, der Literaturnobelpreisträger von 1981 und zeit seines Lebens ein erbitterter „Feind“ des Todes, sondern der Tech-Milliardär Peter Thiel (im Gespräch mit der „Washington Post“ 2015).
Longevity steht ganz oben auf der Agenda des sich als Visionär begreifenden Unternehmers, und zwar nicht in der gemäßigten Variante von Lebensverlängerung durch wissenschaftliche Innovationen, sondern als radikale Verneinung menschlicher Sterblichkeit als solcher. Den Tod hält Thiel für einen Skandal, einen Irrweg, einen korrigierbaren Fehler der Zivilisation.
Dieses heute hochpopuläre Weltbild, dem in meist etwas gemäßigteren Formen auch andere Tech-Gurus wie Jeff Bezos oder Elon Musk anhängen, berührt sich mit dem Denken Elias Canettis, der vor 120 Jahren am 25. Juli 1905 im bulgarischen Rustschuk als Kind einer sephardisch-jüdischen Familie geboren wurde. Der 1938 von Wien nach London emigrierte Schriftsteller entwickelte unter dem Eindruck von Krieg und Holocaust in zahlreichen seiner „Aufzeichnungen“ ein Denken, das die Ablehnung des Todes in all seinen Formen in den Mittelpunkt stellte.
Wie heute Thiel wirft Canetti den Religionen vor, mit ihren Jenseitsversprechen den Tod zu verharmlosen, letztlich zu verleugnen. „Tod, wo ist dein Stachel?“, fragt Paulus rhetorisch und fast spöttisch im Korintherbrief – für Canetti paradoxerweise der Höhepunkt einer mutlosen Anerkennung der Macht des Todes. „Den Tod immerzu fühlen, ohne eine der tröstlichen Religionen zu teilen, welches Wagnis, welches furchtbare Wagnis!“, heißt es in einem Aphorismus von 1947.
Ursprünglich hatte Canetti den „Todfeind“ als Hauptfigur eines Romans in der Nachfolge der „Blendung“ von 1936 vorgesehen. „Während dieses Krieges aber wurde es mir klar, dass man Überzeugungen von solcher Wichtigkeit, eigentlich eine Religion, unmittelbar und ohne Verkleidung aussprechen müsse.“
Diese neu gegründete Gegenreligion ist eng verwandt mit heutigen Utopien des Transhumanismus, auch wenn der Religionsstifter Canetti nicht auf konkrete Techniken wie Kryonik oder Bluttransfusionen setzte, um den Alterungsprozess zu verlangsamen oder buchstäblich auf Eis zu legen, sondern allein auf die weltverändernde Macht des Wortes. Das permanente Anrennen gegen die so unumstößliche Faktizität des Todes liefert wie eine Turbine seinem Schreiben die Energie.
Kaum ein Denker hat so mit dem Tod gehadert wie Canetti – von seinem Drama „Die Befristeten“ bis zu den Ausführungen über das „Friedhofsgefühl“ in „Masse und Macht“. Auch über die Konsequenzen eines todlosen Daseins hat er intensiv nachgedacht: „Wird dann, bei sehr verlängertem Leben, der Tod als Ausweg verschwinden?“
Zum runden Geburtstag erscheinen bei Hanser die ersten Bände einer neuen, kommentierten „Zürcher Ausgabe“ von Canettis Werken. Es ist höchste Zeit, sich wieder mit ihm, den großen Todfeind, zu beschäftigen, auch um mit ihm zu streiten. Canetti fragt selbst: „Wie oft müsste man leben, um aus dem Tod klug zu werden?“
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.