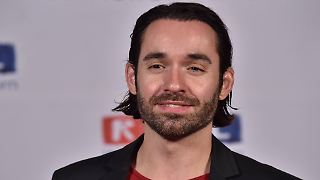Der Wahnsinn hinter Eminem habe System, erläutert Marshall Mathers, während der Mensch hinter der Kunstfigur seine Arbeitsroutine beschreibt und Einblicke in den Entstehungsprozess seiner Songs gewährt. Mit unterschiedlichen Farbstiften werden unterschiedliche Ideen in seinem Writing-Book niedergeschrieben, seine Lyrics gleichen enigmatischen, kaum zu entziffernden Scribbles, beinahe schon Kunstwerke für sich, eine Systematik, die wahrscheinlich nur er selbst zu durchschauen vermag.
Das System soll es schon einige Jahre geben, den eigenen Wahnsinn mag Mathers, 53, mittlerweile also domestiziert haben, aber das ist nur ein Randaspekt dieser Erzählung, in der es eigentlich um den Wahnsinn geht, den Marshall Mathers eben nicht zu kontrollieren vermag. Den Wahnsinn, den die von ihm geschaffene Kunstfigur Eminem in der Welt ausgelöst hat.
Die Dokumentation „Stans“ erzählt nun genau diese Geschichte, die Story von einem der kommerziell erfolgreichsten, kulturell bedeutendsten und technisch versiertesten Rapper aller Zeiten. Aber sie nährt sich dem Künstler aus einer ungewöhnlichen Perspektive, nämlich aus der Perspektive seiner „Stans“. Seiner exzentrischen Superfans – wobei diese verniedlichende Formulierung möglicherweise in die Irre führt.
Der Begriff „Stan“, basiert auf dem gleichnamigen Eminem-Song, in welchem er das obsessive Verhalten eines von ihm besessenen Fans thematisiert und welcher mittlerweile als Synonym für toxisch-obsessives Fantum ein Eigenleben entwickelt hat – die Bezeichnung hat sogar Eingang in das Oxford Dictonary gefunden. Jedenfalls kommen nun genau diese Art von Fans zu Wort, um sich dem Phänomen Eminem zu nähren.
Als Eminems Freund stirbt, bekommt der Superfan einen Nervenzusammenbruch
Das Konzept ist vielversprechend. Zum einen, weil es mit der Flut der neuen, am Fließband produzierten Musiker-Dokus bricht, die für große Streaminganbieter derzeit nach einer immergleichen Formel in Massenware produziert werden. Im Vordergrund steht dabei der Künstler, der an einem vermeintlichen Scheideweg seiner Karriere steht, sich begleiten lässt und rückblickend seinen Karriereweg reflektiert.
Am Ende bewältigt der Musiker seine Aufgabe, seine große Prüfung und der Zuschauer bekommt die Illusion, sein Idol nach gemeinsam vollbrachter Heldenreise nun besser zu verstehen. Dieses immergleiche Strickmuster (Justin Bieber-Doku, Apache-Doku, Bushido-Doku) degradiert echte Musiker-Dokus zu reinem Cash-Grab-Content. Zumindest mit der narrativen Struktur dieser erweiterten Promo-Filme bricht „Stans“.
Das Konzept ist aber auch interessant, weil es das Phänomen des Superfandoms untersucht, einem Thema, dass im Angesicht einer Neudefinition von Prominenz im digitalen Zeitalter von großer Virulenz ist. Waren Stars noch bis in die Nullerjahre dem Durchschnitt entrückte Menschen, kaum greifbar und damit umso begehrenswerter, basiert die Popularität von Stars im Social Media-Zeitalter hauptsächlich auf vermeintlicher Nähe und inszenierter Intimität. Das verändert das Wesen der zugrundeliegenden parasozialen Bindung.
Diesen Wandel und die damit einhergehenden Folgen wären eine spannende Perspektive für „Stans“ gewesen, aber es wäre auch schon spannend genug gewesen, zu ergründen, warum die im Film vorgestellten radikalen Superfans überhaupt das sind, was sie sind. Warum sich eine Frau 22 Eminem-Tattoos auf ihre Haut stechen lässt, warum ein erwachsener Mann einen Nervenzusammenbruch erleidet und für drei Monate nicht mehr die Wohnung verlässt, als er erfährt, dass ein Freund von Eminem verstorben ist. Doch all das tut „Stans“ nicht.
Wikipedia ist informativer als diese Doku
Zwar werden immer wieder einige Identifikationspunkte deutlich, die begründen sollen, warum Eminem die exorbitante Bedeutung in ihrem Leben einnimmt, die sie ihm gewähren (der Star als Underdog, der man selbst auch zu sein glaubt, das verkannte Talent, das man ebenfalls zu besitzen erhofft, Außenseitertum, hinter einer starken Fassade verborgene Verletzlichkeit, etc.) aber das geht nie über Oberflächlichkeiten und Banalitäten hinaus.
Die Dokumentation krankt daran, dass die gezeigten Figuren, die „Stans“, nie tiefergehend vorgestellt werden, sondern lediglich zu skurrilen Stichwortgebern degradiert werden, um die Eminem-Geschichte zu erzählen, die in den vergangenen 25 Jahren in allen bekannten Variationen bereits ausführlich erzählt wurde. „Stans“ fügt da keinerlei neue Erkenntnisse hinzu. Die eigentlichen Stars hätten die „Stans“ sein können, aber das hat man sich nicht getraut, immer wieder müssen Eminem und seine Geschichte in den Fokus gerückt werden.
Dass eine Eminem-Doku, die natürlich von Eminem produziert wurde, krampfhaft versucht nun eben Eminem als zentralen Protagonisten in den Vordergrund zu rücken, dürfte nicht überraschen, zeigt aber, dass hier der Mut fehlte über eine reine PR-Produktion hinauszugehen. Wer sich dem Phänomen Eminem nähren will, der wird durch seinen Wikipedia-Artikel besser informiert. Wer das Phänomen des Superfantums begreifen will, dem ist das Ganze hier zu zahnlos und oberflächlich. Man will seinen Fans ja nicht vor den Kopf stoßen.
Pflichtbewusst endet die Doku dann auch damit, dass Eminem seinen Fans in für einen Lyriker seines Formates beinahe schon unwürdigen Plattitüden dankt, ohne sie, so sagt Marshal Mathers, wäre er nichts, gar nichts, klar, alles, was er mache, mache er nur für sie.
Spätestens jetzt, nach knapp 100 Minuten versaut Eminem damit selbst die Eminem-Doku. Schade, hätte er lieber einmal den Wahnsinn zum Paradigma gemacht, statt sich in das Promo-System zu fügen, dass auf diese Weise nicht mal einen echten Stan zufrieden stellen dürfte.
„Stans“, Regie, Buch: Steven Leckart, ab dem 07. August in ausgewählten Kinos.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.