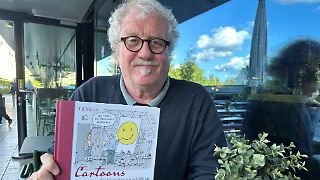Als Lars Eidinger das Titellied des Abends anstimmt, spielt auch das Wetter mit. Ein Gewitter ist aufgezogen, Blitze leuchten durch die Glasfenster der Bochumer Jahrhunderthalle. „I Did It My Way“ singt Eidinger, das Publikum ist begeistert. Wie im vergangenen Jahr, als Sandra Hüller den Auftakt mit Liedern von PJ Harvey bestritt, lockt die Ruhrtriennale mit einem musikalischen Staraufgebot. Eidinger schlägt sich mit Frank Sinatra zwar wacker, doch an diesem Abend glänzt vor allem die grandiose Larissa Sirah Herden („Lary“), die einen mit Nina Simone in Gänsehautdauerschleife versetzt.
Ivo von Hove, Intendant der Ruhrtriennale, erzählt mit „I Dit It My Way“ die Geschichte eines Paares und eines Landes. Während Sinatra für die weißen USA der Vorstädte steht, verkörpert Simone das aufbegehrende Amerika der Schwarzen. „Alles muss sich verändern!“, singt Herden, während ein Kleidungsstück nach dem anderen aus dem Fenster des weißgetünchten Holzhauses fliegt, das Bühnenbildner Jan Versweyveld als Ab- und Urbild jenes Landes entworfen hat, das stets allen Bürgern die Freiheit als kleiner oder größerer Eigentümer versprochen hat und doch nie allen gewährte. Fast könnte man gar den Verdacht hegen, dass das im Prinzip des Eigentums selbst liegt.
Die Zeichen in dieser „White Boy, Black Girl“-Geschichte stehen auf Trennung. Es sind die 1960er Jahre, deren politische Konflikte zu Kompromissen führten, die sich von heute aus betrachtet einigermaßen wacklig ausschauen. „The King of Love is Dead“, singt Herden mit Simone, im Hintergrund laufen Videoschnipsel mit Martin Luther King, Bilder von Protesten, aber auch eines rassistischen Lynchmobs. „Will My County Fall?“, heißt es bei Simone fast schon verzweifelt, doch mit „Feeling Good“ – von Herden zum Niederknien gesungen – kommt bereits das Gegenmittel: die Euphorie der Freiheit.
Während Hüller im Vorjahr unter konzeptioneller Überfrachtung zu ersticken drohte und das nur abwehren konnte, indem sie sensationell dagegen ansang, ist die Dramaturgie bei „I Did It My Way“ stimmiger. Das Zwiegespräch zwischen zweierlei amerikanischer Erfahrung, zwischen Sinatra und Simone, zwischen Eidinger und Herden, bleibt bis zum Ende der fast zwei Stunden spannend, sodass man auch die wenig inspiriert wirkenden Tanzeinlagen und manch einfallslose Videoeinspielung großzügig zu verzeihen bereit ist.
Musikalisch holt Henry Hey mit der auf dem Dach der Hauskulisse platzierten kleinen Besetzung alles raus, da fällt auch kaum auf, dass die Streicher vom Keyboard kommen. Findet „I Did It My Way“ eine charmante Tonlage, um Gesellschaftsgeschichte als musikalischen Dialog zu erzählen, verliert sich „Oracle“ in der Duisburger Kraftzentrale im leerlaufenden Getöse.
Warum „Oracle“ in Duisburg scheitert
Vier Stunden dauert die mit Spannung erwartete Inszenierung von Regisseur Łukasz Twarkowski und Dramaturgin Anka Herbut mit dem litauischen Daile-Theater. Es geht um Alan Turing, der die Geheimcodes der Nazis knackte, um Hedy Lamarr, nicht nur Hollywood-Ikone, sondern auch geniale Erfinderin, und um den Google-Entwickler Blake Lemoine, der einen mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Chatbot als Person mit Bewusstsein bezeichnete. Klingt spannend, ist es aber nicht.
„Oracle“ ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie im Theater die Fähigkeit zum Erzählen mit der rasanten Entwicklung der technischen Erzählmittel verkümmert, geradezu analog zum Denken mit dem Aufkommen von KI. Wobei zu fragen wäre, was genau da Theater zu nennen ist: Live-Film wäre wohl die genauere Bezeichnung.
Das sieht vom Bühnenbild bis zu den Kostümen alles sehr hübsch aus, ist auch sichtlich viel Arbeit, fällt aber hinter den mit „Enigma“ und „The Imitation Game“ von Hollywood in Sachen Turing-Biopic gesetzten Standard zurück. So langatmig und -weilig zu erzählen, dürfte man sich im Kino nicht trauen – und im Theater ohne das ganze Drumherum auch nicht.
Weder als Biopic über Wissenschaft im Zeitalter der Information noch als Essayfilm über die Auswirkungen von KI taugt „Oracle“, da sind Christopher Nolan auf der einen oder Hito Steyerl auf der anderen Seite Lichtjahre voraus. Der Mangel an inhaltlicher und ästhetischer Substanz wird durch Lautstärke und überdrehte Bühnentricks übertüncht.
Ein Abend wie ein außer Kontrolle geratener Effektregler, der peinlich prätentiös und ärgerlich aufgeblasen wirkt. Der vierstündige audiovisuelle Dauerbeschuss entlohnt jedoch nicht einmal mit einem dringend benötigten tieferen Verständnis moderner Kommunikations- und Informationstechnologien oder deren Herkunft aus der militärischen Forschung (bei Turing, aber auch Claude Shannon oder Norbert Wiener).
Grundsätzlich muss man bombastischen, aber zutiefst banalen Abenden wie „Oracle“ vorwerfen, dass sie selbst eifrig an dem „technologischen Schleier“ mitweben, der das Phänomen KI als ideologische Gloriole umgibt. Und weil solche Bedeutsamkeitsblasen, wenn sie denn nur spektakulär daherkommen, heute immer mehr gefeiert werden, muss „Oracle“ als Topkandidat für den größten Theaterflop des Jahres genannt werden.
Die Ruhrtriennale mit den Inszenierungen „I Did It My Way“ und „Oracle“ läuft noch bis zum 15. September.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.