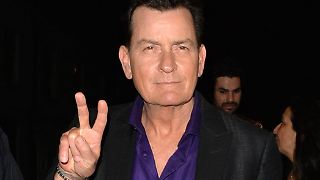Herbert Blomstedt langweilt sich ein bisschen hier draußen am See. Es ist Nachmittag in Bengtstorp, einem mit sanfter Hand in die hügelige Landschaft gekleckerten Dorf ein paar Kilometer von Örebro weg. Der Himmel ist hoch. Noch fliegen die Mücken nicht so tief. Wir sitzen in einer Hollywood-Schaukel. Im ochsenblutfarbenen Haus weiter hinten an der Straße wohnt Blomstedts jüngste Tochter Kristina.
Im Sommer waren die Blomstedts immer hier. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Das weiße Haus mit dem weiten Blick hat der dienstälteste Dirigent der Welt bezogen, weil er von Luzern, wo er jahrzehntelang wohnte, zurück nach Schweden wollte. In Bengtstorp lebt er jetzt. Und in Göteborg, wenn er nicht gerade in Sachen Bruckner und Beethoven unterwegs ist im Leipziger Gewandhaus und in Japan und in der Berliner Philharmonie. Unterwegs zu den vierzig, fünfzig Konzerten, die er noch dirigiert im Jahr. In Spitzenzeiten waren es einmal um die hundert.
Die Wohnung in Göteborg wollte er unbedingt. Ein Zufallsfund in einem Haus, an dem er als Kind auf dem Weg zum Musikunterricht immer vorbeikam. So schließen sich Kreise. Fünf Minuten von Göteborgs akustisch legendärer Konzerthalle entfernt, zehn Minuten von Göteborgs Universitätsbibliothek, wo Blomstedts Bücher sind. Oder zumindest die meisten der dreißig-, vierzigtausend Bände, die er in seinem Leben gesammelt hat. Aber dorthin geht es erst am nächsten Tag.
In diesem Sommer, sagt er, seien es gar nicht so viele Konzerte wie sonst. Also habe er Zeit zum Studieren. Er sei langsam im Lernen. Sei er immer schon gewesen. Und ein Präzisionist. Er wolle immer vorbereitet sein. Sibelius fünfte Sinfonie hat er sich für diesen Sommer vorgenommen. Sie hat er lange nicht mehr gemacht. „Ein kompliziertes Ding.“ Er liest die Partitur. Singt sie im Kopf. Sucht nach Details, die er noch nie gefunden hat. Singt sie vor. Dieses Fagottsolo zum Beispiel. Herbert Blomstedt singt gern.
Und er macht sich Gedanken, was er in zwei Jahren dirigieren soll. Mendelssohns Lobgesang-Sinfonie vielleicht. Aber die halten viele für eher unterkomplex. Er denkt da anders. Er erkärt, er singt. 2027 steht sein nächster runder Geburtstag an. Da wird Herbert Blomstedt hundert Jahre alt.
Einen Rollator braucht er inzwischen. Eine Uhr, die seinen Blutzucker misst und Meldung macht. Unter anderem bei Cecilia, der Tochter, die uns hierher an den See gebracht hat. Cecilia ist Ärztin in Örebro. Eine Ohrentzündung, die ihn Boston erwischt hat, hat er überwunden. Er hört wieder. Ein bisschen schwer, aber es gehe.
Er wolle 120 Jahre alt werden, hat Cecilia unterwegs nach Bengtstorp gesagt. Und wenn man so 120 wird wie Herbert Blomstedt, federleicht und zerbrechlich, gut gelaunt und hellwach, offenherzig und der Zukunft zugewandt, möchte man das vielleicht auch werden.
Siebzig Bibeln im Bestand
Ein Kammermusikflügel steht da. Eine große Tafel. Eine Fotografie von Edvard Grieg hängt über dem Kamin. Bücher liegen herum. Das Faksimile einer Gutenberg-Bibel zeigt er uns. Siebzig Bibeln, sagt er, hat er. Die Bibel begleitet den Sohn eines Adventistenpastors und einer Pianistin durch sein Leben. Das Arbeitszimmer, wo sein Computer steht, wo er studiert, ist das kleinste im Haus. Neben seinem Schlafzimmer. Beide sind vollgestellt mit Büchern. Es hat etwas von einer Klosterzelle. In der Wohnung in Göteborg ist es ähnlich. Er braucht die Enge vielleicht für die Weite im Kopf.
Kristina, Blomstedts jüngste Tochter, hat gekocht. Sie betreibt mit ihrem Mann eine Brauerei im Nachbarort. Was insofern ein bisschen schade ist, als Cecilia und Herbert nicht sagen können, wie das Gebräu schmeckt. Die Blomstedts trinken keinen Alkohol. Und Vegetarier sind sie auch. „Ich hasse die Vorstellung, Tiere zu essen“, sagt Blomstedt.
Andere zu missionieren, liegt ihm aber fern. Herbert Blomstedt ist kein Diktator. Nicht am Pult, nicht im Leben. Ein Ermöglicher. Eigentlich, aber das würde er als pathetisch weit von sich weisen, ein Befreier. Der Partituren und der Musiker. „Musiker sind Engel“, sagt er, „Vermittler von etwas Großem, das ich nur erahnen kann“. Er sei ein Diener. Demut als Tugend findet er gut.
Cecilia und Herbert singen William Byrds Kanon „Non nobis domine“ anstelle eines Tischgebets. Und dann sitzen wir in einer Ledersitzecke, von der wir nicht sicher sind, ob wir je wieder aufstehen werden. Blomstedt erzählt von seinen Büchern, die seine Familie seien. Die seine Einsamkeit teilten, die seinem Wesen entspreche, die essenziell sei für das Dirigentendasein. Dass er schon mit sechs angefangen habe zu lesen. Und zwar alles, was ihm zwischen die Finger gekommen sei. Und seine Lehrer sich fast ein bisschen Sorgen gemacht hätten.
Überall, wo er hinkam, später als Dirigent, nach Oslo, nach Kopenhagen, nach Dresden, Leipzig, San Francisco, habe er versucht, sich alles an Literatur, an Kultur anzueignen, mit dem seine Musiker aufgewachsen waren. In Kopenhagen zum Beispiel kaufte er sich eine 25-bändige Kierkegaard-Ausgabe. Geradezu manisch habe er angefangen, Bücher zu sammeln, die Bände mit Karten zu versehen. Da stehe immer drauf, wann er wo den Band, die Bände, gekauft habe und für wie viel und was drinstehe und was besonders an ihnen sei.
Bücher sind seine Freunde. Von ihnen möchte er nicht getrennt werden. Man geht mit ihm an ihnen vorbei, am Handapparat in seinem Schlafzimmer zum Beispiel. Und er erzählt ihre Geschichten. Es ist wie eine Audioguide-Tour durch die geistige Welt. Altwerden verliert unterwegs einen Großteil seines Schreckens. Wobei man erwähnen muss – Augen auf bei der Berufswahl! –, dass Dirigenten ohnehin eine um 35 Prozent höhere Lebenserwartung haben als der Rest der Bevölkerung.
Cecilia fährt uns nach Göteborg am nächsten Morgen. Dreieinhalb Stunden am Vänern-See entlang. Blomstedts alte Picard-Tasche mit den Partituren ist dabei. Blomstedt hat einen Zahnarzt-Termin in Göteborg. Und wir sind verabredet mit Anders Larsson, Bibliothekar an der Universität, der ein bisschen an Kafkas Hungerkünstler erinnert.
Er hat die Bücher von Herbert Blomstedt von Luzern nach Schweden geholt. 35.000 Bände vielleicht. In einem Truck kamen sie aus der Schweiz. Larsson hat sie katalogisiert. Sie sind im sechsten Stock seiner Bibliothek. In Regalen sortiert nach Themen. Kochbücher, Musikbücher, Philosophie, Politik – Blomstedts Sammlung ist eine der größten, die Larsson verwaltet. Und der vielseitigsten.
Am Eingang prangt Blomstedts Ex-Libris – ein verschnörkelter Buchstabe, der nach dem Vorbild des Signets der Dresdner Staatskapelle gestaltet ist. Jenem Orchester, dessen Chefdirigent er von 1975 bis 1985 war.
Krimis gibts keine. „Das interessiert mich überhaupt nicht“, sagt Blomstedt. Schiller hat er, Poe hat er, die Vorläufer jenes Genres, in dem es Schweden zu Weltruhm brachten, wie in sonst vielleicht keinem.
Bücher, gelagert bei 18 Grad
Larsson ist ein Bibliophiler, ein Bücherwahnsinniger. Es geht einem das Herz auf, wenn man Blomstedt und ihn über Buchbindung und Buchgestaltung fachsimpeln hört. Die besonders wertvollen Blomstedt-Bände sind bei konstant 18 Grad zwei Stockwerke tiefer untergebracht. Etwa seine einzigartige Sammlung der fast vollständigen Edition der kalifornischen Arion-Press – hochwertig gedruckt, auf exquisitem Papier, in extrem geringer Auflage, drei Bücher pro Jahr.
Blomstedt – Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra – war seit 1984 bis vor Kurzem Abonnent. Oder die von Barry Moser illustrierte Bibel. Und da ist noch dieses Buch aus dem 17. Jahrhundert mit dem fünf Meter langen Kupferstich der Leichenzug des Schwedenkönigs Karl X. Gustav – alle Namen der Trauernden sind verzeichnet. Das Gilgamesch-Epos von Arion-Press, das würde er ja noch gern haben wollen, obwohl er eigentlich nichts mehr kauft und das Sammeln eingestellt hat. Mal schauen.
Wir sind in seiner Wohnung. Renovierter Altbau über einem Platz an dem sich die Jeunesse dorée Göteborgs trifft. Unwiderstehlich. Ein uralter Aufzug schleppt uns hinauf in eine üppige Zimmerflucht. 5.000 Bücher sind noch hier. Blomstedts Familie kann man hier unterbringen. Ein Clavichord steht da. Bilder seiner Hausheiligen darauf. Furtwängler, Toscanini, Bruno Walter. Illustrierte Shakespeare-Gesamtausgaben. Eine Wand mit französischen Klassikern – Rousseau, Diderot.
Dreizehn Bände Emerson. David Livingstone, Richard Francis Burton. Kierkegaard. Signiert. Ziemlich teuer. Jedes Buch eine Geschichte. Blomstedt erzählt sie alle. Die dreizehnbändige Emerson-Ausgabe samt der Handschrift eines Originalbriefes. Richard Burtons Reisebericht nach Mekka und Medina in einer Ausgabe von Mitte des 19. Jahrhunderts.
Keine Angst vorm Zahnarzt
Blomstedt streift über die Buchrücken. Erzählt von Probenbesuchen bei Toscanini und Furtwängler und Bruno Walter. Und wie man die Dirigententradition teilen könne in die Nachfolger Wagners und die Mendelssohns, wie froh er sei, dass er einen anderen Zugang habe zu Beethoven und Bruckner als die meisten seiner Kollegen durch Richard Wagner.
Durch Zeiten und die Musikgeschichten fliegen wir, von Kollegen und Musikern. Er erinnert noch alles. Hatten wir schon mal erwähnt, dass im Beisein von Herbert Blomstedt das Altwerden seinen Schrecken verliert?
Nach dem Essen muss er zum Zahnarzt. Das muss man auch mit beinahe hundert. Cecilia begleitet ihn. Wir haben Angst vor Dentisten. Blomstedt nicht. Vielleicht sollten wir mehr Bücher lesen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.