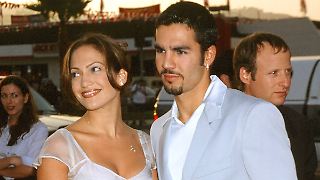Da ist er wieder, dieser unvergleichliche quecksilbrige Erzählton, die munteren Sätze behängt mit Girlanden widersprüchlichster Attribut- und Substantiv-Reihungen. Eine realitäts- und metapherngesättigte Sprache, so hinreißend prickelnd wie ein leichtes Rauschmittel und nicht mehr vernommen seit Arundhati Roys Debütroman von 1997, dem Weltbestseller „Der Gott der kleinen Dinge“. Jetzt nimmt die indische Autorin diesen betörenden Sound wieder auf in ihrer originellen Liebeserklärung an ihre vor drei Jahren verstorbene Mutter. „Meine Zuflucht und mein Sturm“ ist ein höchst vergnügliches Memoir, das zugleich dem konfliktreichen Verhältnis der Tochter zu Mary Roy („Gründerin, Kriegerin, Lehrerin“) gerecht werden und Arundhatis eigene Lebensgeschichte erzählen will.
Sie nennt ihre Mutter eine Gangsterin, „zügellos, mächtig, verrückt, unberechenbar, magisch, frei, wild, gewalttätig, hinterhältig, durchtrieben und paranoid“ und würdigt „ihre Genialität, ihre Exzentrizität, ihre radikale Freundlichkeit, ihren militanten Mut, ihre Ruchlosigkeit, ihre Großzügigkeit, ihre Grausamkeit, ihre Heimtücke, ihren Geschäftssinn und ihr wildes Temperament“. Mary Roy konnte ihre private Umgebung mit ihren dadaistischen Exzessen in Angst versetzen. Noch auf dem Totenbett schleuderte sie Teller durchs Zimmer, wenn sie das Essen nicht mochte, beschimpfte die Tochter („blöde Hündin“) und quälte sie mit Erzählungen von ihren gescheiterten Abtreibungsversuchen. Mary Roy führte ihr Leben lang Krieg gegen ihre beiden Kinder, oft ohne klares Motiv, am heftigsten gegen die Tochter, die Mutters unkontrollierbare Wut stärker zu spüren bekam als der Sohn. Das liest sich temperamentvoll und stellenweise unerwartet lustig.
Mary Roy war eine nationale Berühmtheit
Es gab Mary Roy in doppelter Ausfertigung. Die eine war die prügelnde Berserkerin, die Geißel ihrer Kinder, die alleinerziehende Mutter mit dem lodernden Zorn gegen die Mutterschaft als solche. Die andere war die Visionärin, pädagogische Pionierin und erfolgreiche Karrierefrau, die gemeinsam mit einer britischen Missionarin in Kerala eine Schule gründete, sie Jahrzehnte lang leitete und mittels innovativer Unterrichtsmethoden und einer revolutionären Schularchitektur zu nationaler Berühmtheit führte. Sie begann mit fünfzehn Schülern, darunter Arundhati und ihr Bruder, in zwei angemieteten Räumen im Kottayam Rotary Club. Und sie machte aus ihrer Schule eine der besten Bildungsstätten des Landes, einen ausgedehnten und reich ausgestatteten Campus mit hunderten Internatsschülern: „Meine Mutter wurde Besitzerin, Direktorin und wilde Seele einer einzigartigen Schule in einer einzigartigen Stadt“. Ihr Tod mit 89 Jahren wurde national betrauert und war den Medien ganz Indiens eine Meldung und Würdigung wert.
Es gibt auch Arundhati Roy in doppelter Ausfertigung – als magische Erzählerin und als politische Kommentatorin. Mit achtzehn verließ sie ihr Zuhause, brach für viele Jahre jeden Kontakt zu ihrer Mutter ab („Ich verließ meine Mutter nicht, weil ich sie nicht liebte, sondern um sie weiterhin lieben zu können“) und begann in Neu-Delhi Architektur und Design zu studieren, zunächst ohne ein Wort Hindi zu sprechen. Sie lebte ein experimentelles Vagabunden-Leben und schlug sich durch als Hausbesetzerin, Tagelöhnerin, Gelegenheitsjobberin, bis sie den Drehbuchautor und Dokumentarfilmer Pradip Krishen heiratete und „Der Gott der kleinen Dinge“ schrieb, die semi-autobiografische, ins Märchenhafte enthobene Jugendgeschichte eines Zwillingspaars in Kerala.
Der Roman erreichte eine globale Gesamtauflage von acht Millionen Exemplaren und änderte alles. Über Nacht wechselte die Autorin vom Prekariat in den sorgenfreien Reichtum, und auch das Verhältnis zu ihrer Mutter kippte. Irgendwann war Arundhati Roy nicht mehr die Tochter der berühmten Pädagogin, sondern Mary Roy war die Mutter der berühmten Autorin.
Was tun mit dem plötzlichen Geldsegen? „Der Preis, den ich bezahlte, war eine tiefe, dunkle Traurigkeit in Kombination mit einem etwas verschrobenen Schuldgefühl, das von plötzlichem Ruhm herrührt. Ich begann, öffentliche Angelegenheiten extrem persönlich zu nehmen“. Auftritt der anderen Arundhati Roy, der aufrührerischen Aktivistin und renitenten Globalisierungskritikerin, der Anwältin der Unterdrückten, der wichtigsten Proteststimme gegen den Hindu-Nationalismus und die gewaltsame Modernisierungspolitik Indiens.
Der mitreißende Schwung der ersten beiden Drittel dieses Memoirs erlahmt, der Zauber ist gebrochen. Das letzte Drittel gehört, wie schon in dem missglückten Roman „Das Ministerium des äußersten Glücks“ von 2017, der ermüdenden Aufzählung all der Protestanliegen, für die sich die Autorin eingesetzt, und aller Kampagnen, die sie geführt hat. Ausführlich zitiert sie aus ihren eigenen polemischen Essays und fragt sich einmal selbst: „Ich wollte mich testen. Könnte ich über Bewässerung, Landwirtschaft, Vertreibung und Trockenlegung schreiben, so wie ich über Liebe und Tod in einem Roman schrieb?“ Die Antwort ist leider eindeutig: Sie kann es nicht.
Arundhati Roy: Meine Zuflucht und mein Sturm. Aus dem Englischen von Anette Grube. 368 Seiten, 26 Euro
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.