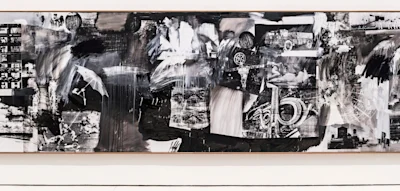Friedrich Merz hat das Wort „Stadtbild“ benutzt und das Internet hat ein Goebbels-Zitat gefunden. Seit Tagen wabert ein Satz des NS-Propagandaministers durch die Feeds, in dem er sich darüber beklagt, wie das „Straßenbild“ durch Juden verändert werde. Viele Aktivisten und linke Politiker, wie zum Beispiel Clara Bünger, die direkt ein Reel in die Welt rausballerte, sehen die Analogie als auf der Hand liegend. Merz sprach von „Problemen im Stadtbild“ und verwies in leicht paternalistischer Tonart auf „die Töchter“, die wüssten, was er meine. Was er genau gemeint hat, bleibt unklar. Die Empörungswelle ließ ihm keine Chance zur Erläuterung. Was folgte, war ein reflexhaftes Aufblähen der Bedeutung. Der Begriff „Stadtbild“ wurde umstandslos mit der Schoah verknüpft, Merz in die Nähe von NS-Rhetorik gerückt.
Die Formel lautete: Wer das Stadtbild problematisiert, spricht wie Goebbels. Und wer „unsere Töchter“ als Argument einführt, instrumentalisiert Frauen für rassistische Zwecke. Dabei wäre es durchaus möglich gewesen, die Äußerung schlicht zu kritisieren: Sie war unpräzise, suggestiv, unnötig aufgeladen. Aber anstatt sich mit den politischen Implikationen einer solchen Sprache auseinanderzusetzen, wurde der Diskurs sofort auf moralisches Maximalniveau gedreht. Merz sei ein gefährlicher Brandstifter, hieß es, ein Mann, der unterschwellig nationalistische Codes reproduziere. Als Beleg diente ein einzelner Tagebuchsatz von Goebbels aus dem Jahr 1941.
Der Vergleich relativiert den Massenmord
Das fragliche Zitat stammt aus dem privaten Tagebuch von Joseph Goebbels, datiert auf den 20. August 1941. Es findet sich im Band 3/2 der vom Institut für Zeitgeschichte edierten „Tagebücher von Joseph Goebbels“, herausgegeben von Elke Fröhlich. Dort notiert Goebbels im Zusammenhang mit der bevorstehenden Deportation der Berliner Juden: „Sie verderben nicht nur das Straßenbild unserer Stadt, sondern auch das sittliche Empfinden unseres Volkes.“ Das Zitat ist also authentisch. Aber es stammt aus einem unmittelbaren Kontext der systematischen Judenvernichtung und lässt sich nicht ohne Weiteres auf eine flapsige Aussage eines heutigen Politikers übertragen, der zwar fahrlässig formuliert, aber keine Deportation vorbereitet. Die historische Dimension dieses Satzes ist so tief in Gewalt, Vernichtung und propagandistischer Hetze eingebettet, dass jeder direkte Vergleich zwangsläufig schief hängt und gleichzeitig die Verfolgung und Vernichtung von Juden relativiert.
Doch der Griff zu solchen Analogien ist in Deutschland längst gängige Praxis. Wer sich über seinen politischen Gegner ärgert, greift nicht zur Analyse, sondern tief in die Analogiekiste. Holocaustvergleiche sind die schärfste Waffe im Meinungskampf und werden entsprechend oft gezogen. Dabei ist es fast gleichgültig, ob die Vergleiche historisch haltbar oder analytisch sinnvoll sind. Es geht nicht um Kausalität oder Kontinuität, sondern um Deutungshoheit. Wer den anderen in die Nähe des Nationalsozialismus rücken kann, hat schon gewonnen. Zumindest im Diskursraum derer, die glauben, Moral beginne bei der Empörung und ende bei der symbolischen Auslöschung des Gegners. Was diese Debatte besonders absurd macht, ist nicht nur die Maßlosigkeit des Vergleichs, sondern auch, wer ihn bemüht. Denn es sind ja ausgerechnet jene Stimmen, die in den letzten zwei Jahren auffällig wenig Interesse daran gezeigt haben, wenn es um tatsächlichen Judenhass auf deutschen Straßen ging.
Nämlich als Synagogen angegriffen wurden, jüdische Familien bedroht und propalästinensische Demonstrationen zum Schauplatz antisemitischer Gewalt wurden. Doch von vielen heutigen Goebbels-Zitierern ist seit 24 Monaten nichts zu hören. Wer „From the River to the Sea“ skandierte, durfte das in ihren Augen als legitime Kritik am israelischen Staat verstehen. Wer rote Dreiecke an Hauswände sprühte, war angeblich im politischen Widerstand. Wer Kufiya trug, demonstrierte nicht Hass, sondern Haltung. Und jetzt, wo Merz das Wort „Stadtbild“ in den Mund nimmt, entdecken sie plötzlich ihre tiefe Liebe zu den Juden. Natürlich nur zu den toten. Denn die Lebenden werden mit ihren Sorgen durchweg ignoriert.
Mit anderen Worten: Der reale Antisemitismus, der sich seit dem 7. Oktober 2023 mit brutaler Deutlichkeit in deutschen Städten gezeigt hat, war diesen Stimmen keine Empörung wert. Dafür reichte es vielleicht zu einem milden „Wir müssen auch über Antisemitismus sprechen“ in Talkshow-Nebenbemerkungen. Aber ganz sicher nicht zum moralischen Furor, den ein einzelnes Wort wie „Stadtbild“ jetzt entfacht. Denn Jüdinnen und Juden interessieren diese Leute nicht um ihrer selbst willen. Sie interessieren sie nur dann, wenn sie als Beweismittel für einen anderen Zweck herhalten können. Die sechs Millionen Ermordeten taugen ausschließlich als argumentative Ressource, nicht als Verantwortung. Dabei ist die Ironie der Situation kaum zu übersehen. Während Merz vorgeworfen wird, er instrumentalisiere Frauen und Töchter, um rassistische Ängste zu schüren, wird im selben Atemzug jüdisches Leid vereinnahmt, um eine politische Pointe zu setzen.
Der moralische Vorwurf lautet: Du benutzt Frauen, um gegen Migranten zu hetzen. Aber es wird mit genau dem gleichen Mittel formuliert, das man selbst verurteilt. Nämlich durch die symbolische Überhöhung einer Opfergruppe zur rhetorischen Waffe. Dass dabei nicht einmal bemerkt wird, wie sehr man sich jener Mechanismen bedient, die man gleichzeitig denunzieren möchte, zeigt, wie weit sich Teile der politischen Öffentlichkeit von jeder Form von Selbstreflexion entfernt haben. Wer sich über instrumentalisierte Töchter empört und gleichzeitig die Schoah als diskursives Eigentum behandelt, hat nichts verstanden. Weder von Frauenrechten noch von Erinnerungspolitik.
Doppelte Standards
Dass ausgerechnet Goebbels jetzt als Kronzeuge herangezogen wird, um Merz zu demontieren, ist deshalb nicht nur politisch schäbig, sondern auch geschichtsvergessen. Es geht diesen Stimmen nicht um Jüdinnen und Juden – es geht ihnen um sich selbst, um die Inszenierung moralischer Überlegenheit. Das Perfide an der aktuellen Erregung ist: Sie funktioniert nur, weil sie sich eines absoluten Vergleichs bedient, den kaum noch jemand zu hinterfragen wagt. Die Schoah wird nicht mehr erinnert, sie wird immerzu verwendet. Als Referenzpunkt, der jedes Argument sofort beenden kann. Als Erzählung, die sich beliebig aufladen lässt – auch dann, wenn es gar nicht um Juden geht.
Genau diese Art der Holocaust-Analogisierung ist längst zum festen Bestandteil linker Rhetorik geworden. Sobald jemand Begriffe wie Ordnung, Rückführung oder eben „Stadtbild“ verwendet, wird der NS-Vergleich aktiviert, als wäre jeder Hinweis auf Veränderung im öffentlichen Raum ein Schritt in Richtung Drittes Reich. Dass diese Rhetorik die Erinnerung entwertet, scheint den wenigsten aufzufallen; dass sie die Sprache politischer Kritik korrumpiert, ebenfalls nicht. Wer Merz in die Nähe Goebbels rückt, spricht nicht aus historischer Sensibilität, sondern aus ideologischer Selbstgerechtigkeit.
Der österreichisch-jüdische Intellektuelle Jean Améry schrieb in seinem Werk „Jenseits von Schuld und Sühne“ (1966), das Erinnern sei kein rhetorischer Akt, sondern eine ethische Haltung. Für ihn bedeutete das Erinnern nicht, aus dem Leid moralische Punkte zu ziehen, sondern „in der Erinnerung die Würde des Opfers zu bewahren“. Wer die Schoah als moralische Munition gegen politische Gegner instrumentalisiert, stellt sich damit – so Améry – ungewollt auf die Seite derer, die Geschichte erneut entwirklichen. Denn das Erinnern verlangt Maß, Kontext und Selbstbindung. Wird es zum universellen Vergleichsrahmen, entwertet es sich selbst.
Améry war kein zynischer Kulturkritiker, sondern ein zorniger Humanist. Gerade deshalb wusste er, dass die Wiederholung nicht bei neuen Tätern beginnt, sondern bei der semantischen Entgrenzung. Wer alles mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt, verliert das Gespür dafür, was der Nationalsozialismus war. Und ebnet damit paradoxerweise genau dem das Feld, was er vorgibt zu verhindern: eine Wiederholung, bei der niemand mehr aufmerkt. Ganz besonders deutlich wird dieser doppelte Standard, wenn wir die Begriffe vertauschen. Wenn „Stadtbild“ als NS-Chiffre gelesen wird – als düsterer Code, der angeblich an Deportationen erinnert –, während „Globalize the Intifada“ – also der Ruf nach einem bewaffneten Aufstand, der historisch und faktisch mit Terror, Messerangriffen, Busbomben und gezielten Angriffen auf jüdische Zivilisten verbunden ist – plötzlich als antikoloniale Einladung zum Kaffeeplausch durchgeht. Der eine Begriff wird mit Goebbels aufgeladen, der andere entpolitisiert, als handle es sich um ein solidarisches Brunch-Motto. Das ist dann kein Skandal. Das ist dann Kontext.
Man kann über Friedrich Merz streiten. Man kann seine Sprache kritisieren, seine Politik ablehnen, seinen Ton unpassend finden. Aber man sollte sich dabei nicht mit fremdem Leid legitimieren. Schon gar nicht mit jenem Leid, das man in anderen Kontexten systematisch bagatellisiert. Wenn Auschwitz zur Twitter-Referenz verkommt und jüdisches Erinnern nur noch als Rammbock gegen Migration dient, dann haben wir das moralische Koordinatensystem endgültig verloren. Dann geht es nicht mehr um politische Differenz, sondern nur noch um moralische Vernichtung. Was bleibt, ist ein Diskurs, in dem jeder gegen jeden das Schlimmste behauptet – und niemand mehr weiß, worum es eigentlich ging. Merz hat ein problematisches Wort gesagt. Die Reaktion darauf war schlimmer. Nicht, weil sie kritisiert hat, sondern weil sie das Erinnern zum Werkzeug gemacht hat – wieder einmal, und wie immer: auf dem Rücken derer, die man angeblich schützen will.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.