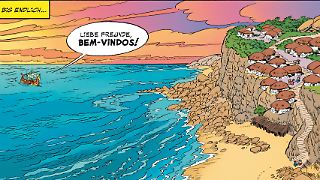Ein Schauspieler spielt einen Songschreiber, der einen Rockstar spielt. Jeremy Allen White wird zu Bruce Springsteen in den frühen Achtzigerjahren: 1981 zieht der junge Sänger in sein erstens eigenes Haus, möbliert, am See in Colts Neck in New Jersey. Ein Freund fährt ihn hin mit seiner Reisetasche und seiner Gitarre. Zu Fuß geht er in die Stadt, kauft sich ein Auto und hört auf der Heimfahrt, was so läuft im Radio. Foreigner mit „Urgent“ und er selbst mit „Hungry Heart“. Der Moderator nennt in salbungsvoll den Boss. Springsteen lächelt in sich hinein und sucht nach einem anderen Sender, bevor seine Stimme und sein Song ihm unheimlich und peinlich werden könnten.
Es braucht nur die eine kleine Szene in „Deliver Me from Nowhere“ von Scott Cooper, um zu zeigen, wer Bruce Springsteen damals war und welcher sogenannte Boss noch immer in ihm lebt. Im Film hat es sein erstes Album auf den ersten Platz der Charts geschafft, „The River“, er kann noch mit seiner alten Kneipenband in Asbury Park auftreten und in Ruhe in den Diners frühstücken. Die Mädchen kichern schon mal, wenn er durch die Straßen läuft. Jungs rufen ihm nach, dass er nerve.
Die Stimme Amerikas ist er noch nicht, er hat auch andere Sorgen. Seine harte Kindheit in Freehold, New Jersey, die an ihm und seinen Liedern zerrt. Die schwarz-weißen Erinnerungen an seine warmherzige Mutter und den Vater, an dem sich der echte Springsteen vor zehn Jahren schon in „Born to Run“, in seinen Memoiren, abgearbeitet hat. Nun erscheint der Vater, Weltkriegsveteran und Fließbandarbeiter bei Ford, Trinker und Schläger, in Gestalt des großartigen Stephen Graham auf den Leinwänden und Bildschirmen. Der kleine Bruce muss in die Kneipen, um ihn heimzuholen. Bruce soll boxen. Aber Bruce tanzt lieber zur Musik im Radio mit seiner Mutter, während sich der Vater in der Küche stumm besäuft.
Wie alle Biopics soll auch „Deliver Me from Nowhere“ zeigen, wer der Mensch hinter einer zum Bild gewordenen Berühmtheit war beziehungsweise ist, wenn sie noch lebt. Warum auch immer alle Welt das heute wissen will, sie möchte es. Die Inflation der Filmbiografien ist der Beweis. Es gibt Grotesken wie „Bohemian Rhapsody“, wo Freddie Mercury von Queen so überzeichnet war, dass er als Witzfigur durch seine eigene Legende tanzen musste. „Walk the Line“ war der Versuch, sich Johnny Cash zum kantigen Sympathieträger zurechtzubiegen. In „Like a Complete Unknown“ wurde Bob Dylan zwar auch zu einem anderen, aber zu einem, dem man diesen Dylan dankbar abnahm, weil Timothée Chalamet ihn so schön spielte, wie er gerade alles spielt.
Auch Jeremy Allen White gehört zu den Kinoplakatgesichtern dieser Zeit. Als Küchenchef kämpft er seit Jahren in der Serie „The Bear“ gegen die äußeren Kalamitäten und die inneren Dämonen für etwas, das größer ist als er. Aus einer Sandwichbude in Chicago macht er einen Foodietempel. In „Deliver Me from Nowhere“ spielt er einen Star, der sich zurückverwandelt in den Songschreiber, der er eigentlich sein will, sich damit gegen den eigenen Aufstieg stemmt und seine Stimme findet, um wirklich zu dem zu werden, den alle zum Boss erklären dürfen.
Manches ist klassisches Biopic: Der Darsteller trägt das verwaschene Karohemd, das Springsteen auf den Fotos der „Nebraska“-Phase trägt. In den kurzen Konzertszenen lässt er die Halsschlagadern anschwellen und schreit, getränkt in Filmschweiß, „Born to Run“ aus sich heraus. White hat sich die Gitarrenschwünge genau abgeschaut und seine Stimme angeraut.
Aber da ist eben noch mehr als einer, der sich nur in eine lebende Figur verwandelt. Springsteen wird nicht einfach dargestellt, er wird gespielt, nach allem, was die darstellenden Künste hergeben, wie er versucht, sich selbst in seinen Songs zu finden. Man sieht tief in ihn hinein. Sein Traurigsein, das Gift, wie er es nennt, in seinem Blut, seine Geschichte. Er zieht sich in seinem Haus am See zurück, schreibt Lieder zur Gitarre und spielt Mundharmonika. Im Fernsehen sieht er „Badlands“, einen Film mit Martin Sheen über den Fall des 18-jährigen Charles Starkweather und seiner Freundin, die zu Serienmördern wurden. Springsteen nennt den Song erst „Starkwheather“, dann schreibt er ihn auf ein lyrisches Ich um und nennt ihn „Nebraska“. Er bekommt ein Drehbuch, das Martin Scorsese als „Born in the U.S.A.“ verfilmen will mit einem Springsteen-Soundtrack, schreibt ein Lied, das er „Vietnam“ nennt und später „Born in the U.S.A.“ All das nimmt er allein auf, mit einem Musikkassettendeck, ein ganzes Album.
Dem Film liegt, neben Springsteens Autobiografie, das Buch „Deliver Me from Home: The Making of Bruce Springsteen’s ‚Nebraska‘“ von Warren Zanes zugrunde. Nach den Heimaufnahmen soll „Nebraska“ ordnungsgemäß eingespielt werden, im Studio mit der E Street Band und hitgemäß gemischt, wie sich das im Geschäft gehört. Springsteen aber will sein Album so unters Volk bringen, wie es entstanden ist, bei Nacht im Schlafzimmer, seine Kassette in Vinyl gepresst. Er schützt „Nebraska“ vor dem Geist der Zeit, vor den Formaten, vor der Rolle, die ihm für die Achtzigerjahre zugedacht ist – und rettet sich selbst.
Es ist auch ein Film über Depressionen. Seine eigenen, die seines Vaters, und, weil er, der Film, seit dem vergangenen Sommer in Amerika und jetzt auch weltweit in den Kinos läuft, die seines Vaterlands. Er ist die Stimme gegen Trump, der Anti-Autokrat, der Sänger aus dem Volk, der Mann, der weiß, wovon er singt, wenn seine Lieder von den kleinen Leuten handeln, so groß er auch immer selbst als Star seit vier Jahrzehnten wirken mag. Ein weites Herz gegen den herrschenden Kleingeist dieser Zeit, ein leiser Film aus einem lauten Land.
Jeremy Allen White zeigt und sagt es in Szenen, in denen er einsam in New Jersey sitzt, „My Father’s House“ für sich allein singt und an alle anderen denkt, denen es geht wie ihm. „Nebraska“ war das Album für den mächtigen und langen Atem für alles, was danach von Bruce Springsteen kam. Es wird zum Film noch einmal neu veröffentlicht mit weiteren Heimaufnahmen und mit den zum Glück verworfenen Rockversionen. Nach „Nebraska“ kam „Born in the U.S.A.“, das Album mit der gleichnamigen Hymne, die Amerika im Geist seinerzeit wirklich wieder groß gemacht hat, in den Achtzigern. Mit allen Brüchen, die niemals verschwinden werden.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.