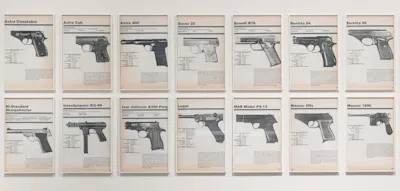An jenem lauen Herbstabend des 13. November 2015 feierte die linke Tageszeitung „Libération“ ihr Abschiedsfest in ihrem langjährigen Redaktionssitz, einem ehemaligen Parkhaus in der Rue Béranger, einen Steinwurf entfernt von der Pariser Place de la République und dem Konzerthaus Bataclan. Die Gäste gingen die ehemalige Rampe hoch, die zu den Großraumbüros führte, als die ersten Eilmeldungen auf den Bildschirmen ihrer Handys aufpoppten. Eine Explosion im Stade de France. Schießereien in Paris. Es klang nach einem Bandenkrieg. Man goss sich Rotwein ein, die Musik lud zum Tanzen.
Im Gebäude befanden sich auch die Journalisten von „Charlie Hebdo“, die das Attentat gegen die Satirezeitschrift zehn Monate zuvor überlebt und bei ihren Kollegen von „Libé“ Unterschlupf gefunden hatten. Als klar war, dass es sich um eine Kette von Attentaten handelte, wurden die Rollläden zum Eingang und zur Tiefgarage heruntergelassen, die Polizei wurde vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Niemand durfte das Haus betreten oder verlassen, während draußen, wenige Fußminuten entfernt, Menschen niedergeschossen wurden.
Ein kollektives Trauma lässt sich daran festmachen, dass jeder weiß, wo er sich befand, als er von den Ereignissen erfuhr, die sich tief in das gesellschaftliche Gedächtnis eingegraben haben. Die Nacht eingesperrt in der Redaktion ist eine persönliche Erinnerung der Autorin dieser Zeilen, die wie die Reporter von „Libé“ gern ihre Arbeit getan hätte. Geblieben sind die Erinnerungen an die frühen Morgenstunden, als in den Rinnsteinen das Blut noch nicht getrocknet war und vor dem Rathaus des 11. Arrondissement, wo noch in der Nacht eine psychologische Anlaufstelle eingerichtet worden war, ein Brautpaar mit seinen Gästen stand, wie ein Vorzeichen darauf, dass das Leben weitergeht, für die meisten.
Überlebende werden sich daran erinnern, wie schnell alles ging. Nur wenige Sekunden. Dann der Geruch, der bleibt, die Mischung aus Pulver und Blut, für immer. Im Bataclan dauerte der Horror zwei Stunden und 18 Minuten. Einer der Männer aus der Sondereinsatzgruppe der BRI beschreibt heute eine Kriegsszene: „Auf dem Boden vor der Bühne lagen geschätzt 500 bis 600 Menschen. Es war still, man hörte nur das leise Jammern der Verletzten.“ Als er mit seinen Leuten um 0 Uhr 58 endlich den Flur gestürmt hatte, in dem die Terroristen elf Geiseln festhielten, mussten diese über die Leichen steigen, um den Konzertsaal zu verlassen. Man riet ihnen die Augen zu schließen. Aber das war gar nicht möglich, wird eine junge Frau später zu Protokoll geben, sie wäre sonst gestolpert.
Es brauchte Zeit, um das Ausmaß zu erfassen: 130 Tote, über 400 Verletzte, tausende traumatisierte Menschen. Später kamen zwei weitere Todesopfer dazu, Menschen, die mit dem Trauma nicht leben konnten und heute als Opfer der Attentate anerkannt sind. Die Anschläge 2015 in Saint-Denis und Paris waren seit dem Zweiten Weltkrieg die blutigsten Attentate in Frankreich und für ganz Europa ein Schock. Nur die Explosion mehrerer Bomben im Vorstadtzug Richtung Madrid, elf Jahre zuvor, hatte mit knapp 200 Toten und fast Tausend Verletzten noch mehr Opfer gefordert.
Nach den Achtziger- vor allem aber Neunzigerjahren, als islamistische Attentäter Frankreich gezielt mit Attentaten ins Visier nahmen, war der Terror 2012 wieder aufgeflammt. Aber anders als bei dem Attentat in einer jüdischen Schule in Toulouse 2012 oder bei der Ermordung von Soldaten, Polizisten oder Journalisten, waren dieses Mal nicht Repräsentanten bestimmter Gruppen gemeint, sondern die ganze Gesellschaft war aufgefordert, sich angesprochen zu fühlen: die westliche Zivilisation, die in den Augen der Täter „Ungläubigen“, hedonistische Wesen, feiernde Menschen, die Alkohol trinken und auf Rockkonzerte gehen.
Zum mageren Narrativ der Mörder gehörte auch, dass sie die Bombardierungen der Hochburgen des Islamischen Staates (IS) in Syrien rächen wollten, an denen sich auch Frankreich beteiligt hatte. „Der Schock war monströs“, erinnert sich der damals amtierende Präsident François Hollande im Gespräch mit WELT. Er hatte sich noch in der Nacht an den Schauplatz begeben und mit Überlebenden gesprochen. In einer Fernsehansprache kündigte er den Ausnahmezustand und die Schließung der Grenzen an. Damals benutzte er das Wort „Horror“.
Zehn Jahre später sitzt Hollande in seinem Büro in der Rue de Rivoli, der Blick aus dem Fenster geht über die Tuilerien, und erinnert sich daran, wie das Land zusammenhielt, wie Frankreich damals standhielt, „wie ein einziger Block“. Es habe keine Demonstrationen gegen muslimische Mitbürger gegeben, betont er, und der rechtsextreme „Front National“, wie Marine Le Pens Partei damals noch hieß, habe in den kommenden Wahlen keinen Gewinn aus den Attentaten schlagen können. Doch das „langsame Gift“ des Terrorismus kontaminiere die Gesellschaft.
Man müsse sich das, sagt Hollande, wie eine lange Zündschnur vorstellen: „Heute gibt es nicht mehr diesen nationalen Zusammenhalt, die Gesellschaft ist gespalten, man ist misstrauisch. Die Idee der Gemeinschaft, die nach den Anschlägen sehr stark war, ist brüchig geworden. Frankreich war schon immer ein Land, in dem man viel gestritten hat. Aber es gab gemeinsame Werte. Heute ist das anders, jeder wiegt sich durch die sozialen Netzwerke in seinen eigenen Gewissheiten und Ängsten.“ Nicht die Immigranten, sondern die französischen Muslime seien zum Feindbild von national-identitären Parteien geworden, konstatiert er.
Hollande bürstet damit die übliche Lesart gegen den Strich. Im kollektiven Narrativ zeichnen sich zehn Jahre nach der Prüfung klare Risse ab. Sicher, Frankreich hat sehr viel Resilienz bewiesen. Doch das Gift des Terrors wirkt langsam und nachhaltig. Jüngstes Beispiel für die Spaltung der Gesellschaft ist eine Äußerung der Abgeordneten Nathalie Oziol von der linksextremen Partei „Unbeugsames Frankreich“ (LFI), die in einem Interview zu Protokoll gab, dass die Ermordung des Lehrers Samuel Paty durch einen jungen Islamisten nicht die Tat eines „fanatischen Muslims“ war, sondern allein auf das Versagen des französischen Schulsystems zurückzuführen sei. Ihre Parteigenossen betreiben dieselbe Verharmlosung, wenn es um den Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel geht.
Dass die Wunde noch längst nicht vernarbt ist, lässt die Zahl der Veranstaltungen erahnen, mit denen der zehnte Jahrestag in Frankreich seit Anfang November begangen wird. Neben Ausstellungen, Dokumentarfilmen, Büchern, einer TV-Serie und einem „Freiheitslauf“ entlang der sechs Schauplätze der Attacken wird der Opfer am Donnerstagabend mit einer Zeremonie auf der Place Saint-Gervais gedacht, in einem eigens angelegten „Garten der Erinnerung“ hinter dem Pariser Rathaus.
Das geplante Gedenkmuseum, „Musée-mémorial du terrorisme“ (MMT), das Präsident Emmanuel Macron wenige Jahre nach den Attentaten für 2029 angekündigt hatte, steht allerdings noch immer nicht. Das 95 Millionen Euro teure Projekt wurde vor einem Jahr von einer Regierung beerdigt, die nicht mehr im Amt war. Die Opferverbände waren schockiert, der Präsident ruderte wenige Wochen später zurück. Nun soll das Projekt in einer stillgelegten Kaserne im 13. Arrondissement zur Hälfte der Kosten entstehen und spätestens Anfang 2030 eingeweiht werden.
Aus den vielen Bemühungen der kollektiven Bewältigung sticht das „Programme 13-Novembre“ heraus, das wissenschaftliche Experiment eines Historikers und eines Neuropsychologen, das sie kurz nach den Attentaten begonnen und im Abstand von mehreren Jahren fortgesetzt haben. Dafür haben sie eine Kohorte von rund 1000 Personen befragt, direkte Opfer, Menschen, die einen Partner oder ein Kind verloren haben, medizinische oder polizeiliche Einsatzkräfte, aber auch Bürger, die alles nur aus der Ferne mitbekommen haben. Ein Teil der Gruppe unterzog sich regelmäßigen MRTs, um die Fähigkeit des Gehirns zu untersuchen, unfreiwillige Bilderströme bewusst zu unterbrechen. Ziel der Untersuchung ist es, die Konstruktion und Entwicklung des individuellen und kollektiven Gedächtnisses und der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zu verstehen und Therapien zu verbessern. „Wir zeigen, dass man von einem Trauma heilt, wenn es gelingt, eine Erzählung zu formulieren, die das Ereignis in die Vergangenheit rückt“, resümiert der Historiker Denis Peschanski vom nationalen Forschungszentrum CNRS.
Aus den 4500 Stunden Videoprotokollen der Wissenschaftler hat die französische Filmemacherin Valérie Mannes eine erschütternde Dokumentation gemacht. In „13 Novembre – Nos vies en éclats“ („Unsere zerbrochenen Leben“) kann man beobachten, wie sich die Überlebenden über die Jahre verändern, wie das Trauma Spuren in ihren Gesichtern und Körpern hinterlässt, wie sie den Kampf mit der Erinnerung gewinnen oder verlieren. Erschütternd ist der leere Stuhl des Bataclan-Überlebenden Fred Dewilde bei der vorerst letzten Aufzeichnung im Frühjahr dieses Jahres. Er hatte sein Trauma in Graphic Novels zu verarbeiten versucht, aber seinen Kampf mehr als acht Jahre nach dem Anschlag verloren.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.