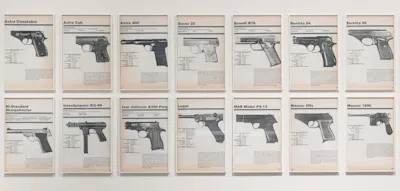Der Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gaza-Streifen ist einer der emotionalsten und komplexesten Konflikte unserer Zeit. Er erschüttert nicht nur den Nahen Osten, sondern prägt Debatten, Proteste und Identitäten weit über die Region hinaus. Besonders in Deutschland wird diese Auseinandersetzung mit einer Intensität verfolgt, die nahezu einzigartig ist. Doch warum fällt die Berichterstattung darüber so schwer – und warum begegnen so viele Menschen Medienberichten mit Misstrauen?
Eine Studie der Universität Mainz zum Medienvertrauen zeigt: Nur 27 Prozent der Deutschen vertrauen Berichten über den Gaza-Krieg. Das ist einer der niedrigsten Werte unter allen politischen Themen. Der Nahost-Konflikt ist längst nicht nur ein geopolitisches Ereignis. Er ist ein Projektionsfeld für Geschichte, Moral, Identität – und für den Kampf um Deutungshoheit.
Besonders aus Israel und der jüdischen Diaspora ist ein Vorwurf häufig zu hören: Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023, bei dem mehr als 1200 Menschen ermordet und Hunderte verschleppt wurden, rücke in der Berichterstattung zu oft in den Hintergrund. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, formuliert es im Podcast „Constantin Schreiber“ so: „Jeder Krieg hat einen, der anfängt und einen, der sich verteidigt.“ Das, so Döpfner, werde oft vergessen oder verdrängt.
Tatsächlich erscheint in vielen Berichten der Begriff „7. Oktober“ mittlerweile als stehender Begriff, ohne dass die Ereignisse selbst erneut erklärt werden. Für Menschen, die den Konflikt nur punktuell verfolgen, kann dadurch der Eindruck entstehen, Israels militärische Aktionen fänden ohne Auslöser statt. Diese Frage ist daher nicht rein formal: Sie berührt die Grundlagen journalistischer Darstellung. Was ist Kontext – und was ist Gewichtung? Er verstehe nicht, so Döpfner, „wie bestimmte journalistische Standards plötzlich umgedeutet wurden, dass sozusagen Berichte oder Zahlen und vermeintliche Fakten der Gesundheitsbehörde der Hamas sozusagen als objektive und nicht mehr noch zusätzlich zu überprüfende Fakten transportiert wurden.“
Gleichzeitig werde Israel hingegen einer besonders peniblen journalistischen Betrachtung unterzogen. Eine Analyse, die Melanie Amann, ehemals stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin, bereits im Mai bei „Constantin Schreiber Late Night“ bestätigte: „Ich habe manchmal den Eindruck, dass man bei allem, was die israelische Regierung macht, immer tausendprozentig kritisch hinguckt und bei der palästinensischen Seite, weil man einfach diese Not sieht und diesen Bombenterror und diese schreckliche Lage der Zivilbevölkerung, dass es da dann eine Tendenz gibt wegen der Empathie und dem Mitgefühl, vielleicht auch Zahlen zu übernehmen, die man von dort hat.“
Warum die andere Seite oft weniger sichtbar ist
Umgekehrt kommt aus palästinensischen, arabischen und muslimischen Communitys in Deutschland häufig ein anderer Vorwurf: Dass Berichte über die israelische Gesellschaft, über Angehörige von Geiseln oder israelische Politiker leichter Zugang zu Medien finden – während Stimmen aus Gaza kaum zu hören seien. Ein Grund dafür liegt vielleicht in den Bedingungen vor Ort. Aus dem Gaza-Streifen kann derzeit nicht frei berichtet werden. Für ausländische Journalisten ist der Zugang de facto unmöglich, weil das israelische Militär sie nicht in das Gebiet lässt. Wer berichten will, ist auf lokale Kollegen angewiesen – und diese sind gleich zwei Risiken ausgesetzt: Gewalt durch israelische Luftangriffe und Repression durch die Hamas.
„Kritik an der Hamas kann lebensgefährlich sein“, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Mehrfach habe es Verhaftungen oder Übergriffe gegeben, wenn Journalistinnen über Proteste oder politische Widersprüche berichten wollten. Selbst grundlegende Informationen wie Bildmaterial oder unabhängige Zeugenaussagen sind schwer zu bekommen.
ARD-Korrespondent Christian Limpert beschreibt im Podcast „Constantin Schreiber“ ein Beispiel: Anfang 2024 gab es Berichte über Proteste gegen die Hamas-Herrschaft im Gaza-Streifen. Doch die wenigen Personen, die für deutsche Medien vor Ort arbeiten, konnten nicht frei filmen. „Da fehlen uns dann belastbare Bilder – und ohne Bilder wird Berichterstattung im Fernsehen extrem schwer“, sagt Limpert.
Hinzu kommt: Der Konflikt ist einer, der in besonderer Weise auch im Smartphone stattfindet. Videos, Appelle, Vorwürfe, Fake News – all das zirkuliert millionenfach auf TikTok, Instagram oder X, oftmals ohne Kontext. Algorithmen verstärken Emotionalität. Empörung verbreitet sich schneller als Einordnung. „In jedem Krieg wird nicht nur mit Waffen gekämpft, sondern auch mit Informationen“, sagt Michael Haller, emeritierter Professor für Journalismusforschung an der Universität Leipzig. In diesem Krieg galt das vielleicht mehr denn je.
Das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung journalistischer Arbeit. Menschen, die vor allem arabische Medien konsumieren, sehen fast ausschließlich das Leid in Gaza. Menschen, die israelische Medien konsumieren, sehen vor allem die Bedrohung durch Raketen, Tunnelanlagen und Geiselnahmen. Deutsche Medien erscheinen dann vielen als zu „kalt“, zu „mittelnd“, zu „distanziert“ – oder im Gegenteil als zu „parteilich“, bizarrerweise weil sie mehr als nur eine Perspektive zeigen.
Deutschlands historische Verantwortung
In Deutschland kommt ein weiterer Faktor hinzu: Die Erinnerung an die Schoah und die Verantwortung gegenüber jüdischem Leben sind fest verankert– bis hin zur „Staatsräson“, die Bundeskanzlerin Angela Merkel einst formulierte. Die Frage, wie Medien in diesem Rahmen berichten, wird von manchen kritisch hinterfragt. Die Kommunikationswissenschaftlerin Nadia Zaboura warnt vor der Gefahr, dass journalistische Distanz unter politischen Leitbegriffen leiden könnte. Im Podcast „Studio M“ sagte sie hierzu: „Ich möchte sehr gern diesen Passus Staatsräson versus Journalismus aufgreifen. Weil ich finde, dass darüber eigentlich zu wenig geredet wird. Staatsräson ist vom Konzept her top-down. Es ist etwas, was von oben quasi hineingegeben wird. (…) Und jetzt möchte ich gerne hinterfragen, was Journalismus ist, der sich einem Top-down-Konzept beugt.“
Häufig wird in diesem Kontext vorgebracht, dass Kritik an Israel vorschnell als antisemitisch gelabelt werde. So sagte Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, im Podcast „Hotel Matze“, sie finde es problematisch, wenn bei Kritik an Benjamin Netanjahu gleich die „Antisemitismus-Keule kommt“. Dass der Vorwurf bei Berichterstattung schnell im Raume stehe, bestätigt Christian Limpert: „Ich wurde schon Antisemit genannt. Aber ich weiß: Meine Arbeit ist nicht antisemitisch.“
Gleichzeitig betont Michael Haller, dass Journalismus auch immer in einem gewachsenen historischen und gesellschaftlichen Kontext stattfindet: „Wenn man das berücksichtigt, dann gibt es gar keine Neutralität bei der Kriegsberichterstattung. So wenig wie wir neutral sind in Bezug auf den Ukraine-Krieg, der uns auch unmittelbar in Europa bedroht und viele Risiken zeigt, sind wir auch hier nicht neutral. Aus verständlichen Gründen, weil in beiden Fällen auch ein Wertesystem angegriffen wird, also ein demokratisches, informationsoffenes Wertesystem angegriffen wird, das wir auch verteidigt sehen wollen, weil es auch unser Wertesystem ist.“
Was diesen Krieg so besonders macht, ist die Tatsache, dass jede Darstellung selbst als Teil des Konflikts gelesen wird. Worte werden gewogen, Auslassungen interpretiert, Bilder kontextualisiert. Jede Form von journalistischer Auswahl wirkt wie ein Statement.
Und doch: Trotz aller Vorwürfe, Verzerrungsdebatten und Vertrauenskrisen ist die Vielfalt der Berichterstattung enorm. In deutschsprachigen Medien kommen israelische, palästinensische, jüdische, arabische, wissenschaftliche, militärische, humanitäre und politische Perspektiven zu Wort. Die Herausforderung liegt darin, ihnen allen journalistisch angemessenen Raum zu geben.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.