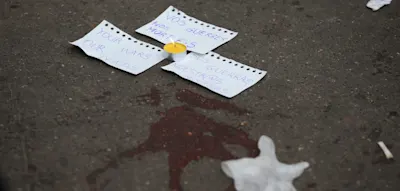Hallt wie ein Ruf von sehr weit weg: „Beuys“. War da was? Erinnert sich noch einer an die Kunstaufregung in fernen Wirtschaftswunderjahren? An den hageren Mann, der Filzplatten auf eine Tannenspitze legte und „Schneefall“ dazu sagte. Der im rheinischen Dialekt von der Versöhnung der Gegensätze predigte und dem sie damals nachliefen wie Jesus beim Einzug in Jerusalem. Versunken, vergessen. Geschichte im Grabesdunkel.
Die Zeitgenossen sind verstummt. Die Ehrfurcht ist ernüchtert. Spätestens seit Hans Peter Riegels Dekonstruktion der wuchernden Legenden („Beuys. Die Biographie“, Aufbau Verlag, 2013) hat der Künstler mit dem Rangplatz auch das Andenken eingebüßt. Und die Jahre, in denen seine Installationsräume fast nicht betretbar waren, weil sie noch von ihm selbst eingerichtet worden waren, sind längst vorbei.
Uneinholbar jedenfalls ist die Faszination, die einmal von dem verrätselten Werk und mehr noch von den rituellen Auftritten des Joseph Beuys ausging. Es gibt kaum eine zweite künstlerische Karriere im 20. Jahrhundert, die die Verehrungsbereitschaft geradeso stimuliert hat wie den populären Verdacht arglistiger Verhöhnung des Normalempfindens. Eine ganze Generation lang war der Mann mit dem angewachsenen Hut die Verkörperung gleichsam jener zum Mythos gewordenen Moderne, die das Schicksal ihrer Unverständlichkeit mit priesterlicher Gebärde besänftigte. Aufs Ganze gesehen ein Lehrbeispiel für die Vergänglichkeit einer Kunst, die ihr eigenes Idiom wie ein Geheimnis hütet, bis das Interesse am Geheimnis erschöpft ist.
Dass der heilige Jupp, wie ihn die skeptischen Freunde nannten, noch einmal sein Wesen treiben würde wie der Geist von Hamlets totem Vater, ist kaum zu erwarten. Umso überraschender kam die Einladung zur Beuys-Ausstellung in der Tübinger Kunsthalle. Sagen wir es gleich: Das festliche Requiem ist nicht zu befürchten. Es ist die hellwache, neugierige Werkbesichtigung einer jungen Generation, die weder den Mythos noch die Entmythologisierung braucht und sich fast ausschließlich mit dem Zeichner beschäftigt, dem zu Lebzeiten entschieden weniger Aufmerksamkeit galt als seinen Filz- und Fett-Einlagen.
Das ist umso spannender als es sich bei den Beuys-Zeichnungen um eine meist beiläufige Produktion handelt, die eher selten gezeigt wurde und das Profil des Kunst-Aktivisten allenfalls illustrativ zu ergänzen schien. Skizzen, Einfälle, Kritzeleien, immer leicht halluzinierend zwischen fließender Linie und Gegenstand, den kopfgeburtlichen Vorgängen nachträumend. Grenzgänge zwischen Unbewusstem und halb Bewusstem, die Bildabsicht geradeso wie den Bildanspruch vermeidend. Der Strich zuweilen hauchzart, als scheute er seine Materialisierung, scheute die Berührung mit der Unterlage.
Es ist, als schaute sich der Zeichner selbst wie durch einen Vorhang zu, hinter dem er nur ein paar Umriss-Andeutungen wahrnimmt. Eine gekrümmte Aktfigur etwa, die ihm mit ihren löffelartigen Ohren als „Hasenfrau“ erscheint. Wohl fallen dem Werk-Kenner gleich mancherlei Kunst-Zeremonien ein, bei denen Beuys mit kuscheligen Hasen, toten, ausgestopften, nachgeschaffenen hantiert hat. Er hat dem Hasen auf dem Schoß die Bilder erklären wollen und ist mit honigverschmiertem Gesicht und ausgewachsenem Stallhasen vor seinem amüsierten Publikum entlanggekrochen. Und wer zur seinerzeit treuen Entourage gehört hat, war auch dabei, als der Meister den Hasen wie eine Monstranz emporgereckt hat.
Aber all das darf man vor der Zeichnung tunlichst vergessen. Denn mehr als ein Spot auf eine Idee, eine aufblitzende Anspielung lässt sich dem rasch und ohne Korrektur gezeichneten Zwitter nicht entnehmen. Und das ist immer noch – und vielleicht erst heute von beträchtlicher Magie. Und auch wenn die Ausstellung sich rechtschaffene Mühe gibt und das Zeichnungskonvolut nach „Tieren“, „Pflanzen“, „Archaischen Frauen“ oder „Phantasiewesen“ ordnet, werden keine konzisen Geschichten daraus. Alles bleibt in der Schwebe und verlässt nirgendwo den geschützten Raum der Möglichkeit.
Spiritualität und Paradiesversprechen
Überaus erhellend die Rückblende zu den Werkanfängen des Düsseldorfer Kunststudenten. In Nachbarschaft von Leistungsträgern des informellen Zeitstils wie Fritz Winter oder Willi Baumeister nehmen sich Beuys’ Arbeiten der 1950er-Jahre nicht gerade auffällig aus. Deutschland war nach dem Abstraktionsverbot der Nationalsozialisten im internationalen Kunstvergleich nicht mehr satisfaktionsfähig. Man musste die neuen Standards erst wieder lernen. Und man lernte rasch, dass es damit nicht getan war, die Gegenstände der Abstraktion geopfert zu haben. Denn das angeblich befreite Sehen schuf sich sogleich seine eigenen neuen Gegenstände: unsichtbare, numinose, absolute, heilige, mythenferne.
Im Bildhauer Ewald Mataré fand Joseph Beuys den trefflichen Akademielehrer, der ihm vormachte, wie sich die freie Form mit Inhalt füllen lässt, ohne dass sie zum Zeichen wird. Und die enorme Aufmerksamkeit, die Beuys mit seinem prophetischen Erscheinen schon früh erregte, macht anschaulich, welche Rolle die Zeitkunst übernahm. Mit ihren diesseitigen Paradiesversprechen befriedigte sie den spirituellen Bedarf einer ausgehungerten Gesellschaft. Die hatte zwar noch immer Mühe, sich ein schwarzes Quadrat als Gipfelpunkt der Malerei vorzustellen. Aber mit den Nymphen, Nornen, Nebelfrauen, den Hexen, der Frau Venus und der Bienenkönigin, die der famose Joseph Beuys aufbot, pflegte sie doch wärmeren Umgang. Es war im unwahrscheinlich fernen Jahr 1957, als der Künstler auf ein Stück Pappe farbige Streifen aufgetragen hat, dass man an Treppenstufen denken könnte. „Zu den Wurzeln herabgestiegen“, so hat er das kleine Bild genannt. Zu den Wurzeln herab – ein anderes Programm hat er in Wahrheit nicht gekannt.
Und diese Wurzelrichtung, das entschiedene Zurück zu Ur-Anfängen musste umso suggestiver erscheinen, als die lebensweltliche Erfahrung von unaufhaltsamen Fortschritten bestimmt war. In Beuys’ magerer Sinnlichkeit ließen sich Sinnangebote vermuten, die das Werk mit rigidem Anspruch über die Ästhetik der Gegenwartskunst hinaushob. Dafür war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein eklatanter Bedarf. Die einen pilgerten als Sannyasin in den Ashram nach Poona, die anderen widmeten sich als treue Jünger der Beuys-Nachfolge. Es hört sich wie ein Märchen an, wenn man vom ungestümen Heilsverlangen der Väter und Großväter erzählt. Und nie mehr in der vordigitalen Epoche klang eine arkane Kunstsprache so verführerisch nach Letztbegründung.
Versunken, vergessen. Geschichte im Grabesdunkel. Zerfahren, aufgelöst, all die Mystifikationen, die der Künstler und seine treu ergebene Boygroup gehütet haben.
Kopfschüttelnd steht man vor den alten Videos, auf denen der Künstler wie ein Straßen-Prediger seine Weistümer verteilt. Die Mischung aus nordischer Legende, Swedenborg-Mystik, Anthroposophie und grünem Gutmenschentum ist nur mehr schwer erträglich. Längst sind sie zu versteinerten Rätseln erstarrt, die plastischen Reliquien, die von den Beuys-Aktionen und -Installationen geblieben sind.
Wer – wie der Autor – bei den Fußwasch-Zeremonien der „Celtic“-Aktion 1971 unter der Baseler Autobahnbrücke dabei war. Wer herumstand, als Beuys 1972 in seinem Documenta-Büro „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ dozierte. Oder wer ihn 1979 im New Yorker Guggenheim-Museum erlebte, als er in wundersamstem Krefelder Englisch den amerikanischen Reportern die Welt erklärte, der kann die Ergriffenheit nicht mehr so ganz verstehen, die uns alle einmal die Rückkehr der rückständigen Deutschkunst in die internationalen Schlagzeilen feiern ließ.
Dafür kann man sich heute ohne Gefahr für Leib und Leben noch einmal den Beuys-Zeichnungen zuwenden. Das ist von großem, währendem Zauber, wie da ein Künstler seinen schleichenden Traumspuren folgt, wie ihm der Zeichenstrich mit Insektenleichtigkeit davonfliegt, wie ihm Figuren geraten und missraten, wie er selbst verwundert dem Lavastrom aus wurzelsüchtigen Geistesabgründen nachsieht. Wenn nichts Bestand hat: Sie ist geblieben, die unverkennbare Zeichenschrift. Also auf zum veritablen Beuys-Revival in die Tübinger Kunsthalle.
„Joseph Beuys. Bewohnte Mythen“, bis 8. März 2026, Kunsthalle Tübingen
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.