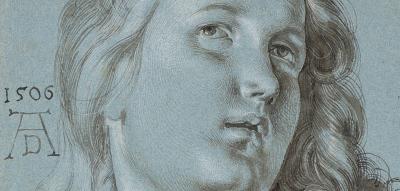Rod Dreher hat sich als konservativer Publizist einen Namen gemacht, der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance zählt zu seinen Fans, Dreher wiederum hat als Autor des Magazins „The American Conservative“ seinen Teil zur Popularität von Vances Buch „Hillbilly-Elegie“ beigetragen.
Dreher, Jahrgang 1967, stammt aus einer Methodisten-Familie, konvertierte 1993 zum Katholizismus und 2006 schließlich zum orthodoxen Christentum. Er ist Autor mehrerer Bücher über die Entzauberung der westlichen Welt und vertritt die These, dass der Westen nicht überleben kann, wenn er seine materialistische Weltanschauung nicht infrage stellt. In deutscher Übersetzung ist sein Buch „Die Benedikt-Option: Eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft“ erschienen.
WELT: Die christlichen Traditionen enthalten wertvolle Schätze, schreiben Sie. Ist Gott Teil des Konservatismus – als eine Art „Erbe“ dieser Traditionen?
Rod Dreher: Ja, das glaube ich, doch nicht nur aus Gründen des kulturellen Erbes. Die Konservativen glauben an die natürliche Hierarchie und an eine dauerhafte moralische Ordnung, die in der Transzendenz verwurzelt ist. Gott ist das Flussbett, in dem die Menschheit ihr Rettungsboot verankert, gegen den Strom der Zeit. Selbstverständlich ist der Glaube an Gott keine Voraussetzung, um politisch rechts zu stehen, und ich verlange auch von niemandem einen Test in Sachen theologischer Reinheit, um ihn als Konservativen anzuerkennen.
Ich habe atheistische Freunde, die sich ebenfalls als konservativ betrachten und dementsprechend wählen. Und ich respektiere sie natürlich. Dennoch ist der Glaube an Gott ein natürliches Element des Konservatismus und vielleicht auch teilweise „notwendig“. Ohne eine solide Verbindung zu einer von der Zeit unabhängigen Quelle wäre der Konservatismus einfach nur ein verzögerter Liberalismus.
WELT: Inwiefern ist diese Transzendenz notwendig?
Dreher: Ohne die Existenz Gottes gibt es keine ultimative Grundlage für die moralische Ordnung. Es gibt keine absolute moralische Norm. Sie müssen auch bedenken, dass der Konservatismus ohne Gott – ohne den biblischen Gott, den im Westen einzig vorstellbaren – Gefahr läuft, zu einer simplen Nostalgie zu werden oder vielleicht zu einem Kult aus der Vergangenheit. Es wäre eine sterile Angelegenheit, eine tote Materie. Um Gustav Mahler zu zitieren: Es geht um die „Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche!“
So wie die Kirche ständig Reformen braucht, sind auch in der Gesellschaft und im Staat Reformen notwendig. Wenn wir uns dabei auf Gott beziehen, gibt uns das einen gewissen normativen Maßstab außerhalb unseres Selbst, nach dem wir uns richten können. Unser wichtigstes Ziel darf dabei nicht einfach nur die Wahrung der Vergangenheit sein, sondern die Gerechtigkeit.
Hier ein Beispiel: Ich komme aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Dort, im Süden, haben die weißen Konservativen gegen die Bürgerrechtsbewegung der 1950er- und 1960er-Jahre gekämpft, weil sie diese zu Recht als eine Bedrohung für die bestehende Rassentrennung ansahen, wollten aber nicht anerkennen, dass diese rassistische Gesellschaftsordnung weder durch konstitutionelle noch biblische Normen gerechtfertigt werden konnte. Ob man es glaubt oder nicht, zahlreiche protestantische weiße Pfarrer haben die Rassentrennung damals im Namen der Bibel verteidigt.
Ich bin 1967 geboren, nachdem man sie politisch bereits bezwungen hatte, doch ihre Gesinnung ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden. Als Jugendlicher konnte ich auch unter den Christen der Generation meiner Eltern und meiner Großeltern eine Portion Rassismus feststellen. Das brachte mich damals zu der Schlussfolgerung, dass das Christentum im Grunde nichts anderes war als eine Ideologie der herrschenden Klasse und sogar eine Möglichkeit, Gott zur Rechtfertigung einer bestimmten sozialen Ordnung zu benutzen.
Mit siebzehn besuchte ich dann die Kathedrale von Chartres und erkannte in einem Augenblick der Erleuchtung, dass im Glauben so viel mehr lag als das, was ich in meiner kleinen Stadt im Süden kennengelernt hatte … und ich verstand. In der Gesellschaft meiner Kindheit ignorierten die konservativen Weißen – und alle Weißen waren damals konservativ – die klare und eindeutige Lehre der Bibel über die Gerechtigkeit und die Menschenwürde. Der schwarze Pastor Martin Luther King antwortete auf den Rassismus der weißen Gesellschaft im Süden, indem er sich auf die Bibel berief, von der die konservativen Weißen im Süden doch alle behaupteten, dass sie an sie glaubten.
WELT: Sie halten also nichts von der Trennung von Kirche und Staat?
Dreher: Oh doch! Die säkularen Liberalen behaupten immer wieder, dass die gläubigen Konservativen eine Theokratie einführen wollen. Das stimmt nicht – oder zumindest sollte es nicht so sein. Wir haben ja bereits erlebt, wie die Absolutierung Gottes in einer politischen Ordnung zur Tyrannei führen kann.
Eine der Ursachen, warum man in Irland den Glauben verloren hat, bestand darin, dass die institutionelle Kirche und der irische Staat – obwohl es sich nicht um eine Theokratie handelte – eng zusammengearbeitet haben. Der Staat hat zahlreiche Sexualverbrechen verschleiert. Wir haben dasselbe in den überwiegend katholischen Städten New Orleans und Boston erlebt, in denen die Kirche über einen enormen politischen Einfluss verfügt. Das hatte katastrophale Folgen für sie und bedeutete gleichzeitig eine Warnung: Die Kirche darf sich der politischen Macht nicht zu sehr annähern. So ist es übrigens auch ein Fehler der Christen, von den Politikern zu erwarten, dass diese ihnen eine bessere Welt liefern und den Dingen einen Sinn geben.
WELT: Die angelsächsischen Konservativen sprechen ganz offen über ihren Glauben, was für andere, wie beispielsweise die Franzosen, schwer zu verstehen ist, da diese sehr am Laizismus hängen. Wie kann man Laizismus richtig verstehen?
Dreher: Gott ist ja keine politische Figur, und ich werde dementsprechend unruhig, wenn Politiker zu viel von Gott reden … Angesichts der Herausforderung durch den Islam erleben wir jedoch, dass einige liberale Atheisten zugeben, dass die Dinge, die sie in einer liberalen Demokratie am meisten bewundert haben, Werte sind, die aus dem Christentum stammen. Das ist beispielsweise auch der Hauptgrund, warum die islamische Konvertitin Ayaan Hirsi Ali Christin geworden ist.
Dem Islam gegenüber kann die Laizität keinen Halt bieten: In diesem Konzept liegt keine Stärke, nichts, was die Seelen der Menschen bewegen und ihrer Fantasie Flügel verleihen könnte. Während meiner Recherchen für mein letztes Buch „Wie man in einer Welt, die ihn vertrieben hat, wieder Geschmack an Gott findet“, habe ich entdeckt, dass der Atheismus und der Materialismus – den zahlreiche westliche Christen selbst passiv akzeptieren – im Grunde genommen ein modernes westliches Phänomen bleiben. Der Rest der Welt denkt ganz anders.
Die westliche Psychologie unterscheidet sich sehr von der Psychologie der meisten Völker auf dieser Erde! Unsere Neigung zur Säkularismus und Materialismus ist das Produkt eines langen, historischen Prozesses, der uns zwar den wissenschaftlichen Fortschritt und einen großen Reichtum beschert hat. Er hat uns aber auch die Fähigkeit gekostet, Dinge des Geistes wahrzunehmen. Was die Menschen im Westen für eine Tatsache halten, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Art und Weise die Welt zu sehen, die höchstwahrscheinlich falsch ist. Weder unsere Vorfahren noch unsere Zeitgenossen im Rest der Welt teilen diese materialistische Anschauung. Sollten wir nicht die Demut aufbringen, uns selbst infrage zu stellen?
WELT: Für gewisse Konservative ist Geld fast schon „Mammon“. Die Protestanten aber, die ja die amerikanische Kultur geprägt haben, sehen darin, ganz im Gegenteil, einen Segen Gottes, um es vereinfacht zu sagen. Kann ein Konservativer wirklich liberal sein?
Dreher: Wir haben hier den Hauptunterschied zwischen dem europäischen und dem anglo-amerikanischen Konservatismus. Für Englischsprachige bedeutet „Konservatismus“ einen Liberalismus der Rechten. Der europäische Konservatismus ist dagegen eher eine Reaktion auf die Französische Revolution. Der anglo-amerikanische Konservatismus, der auf einer protestantischen Kultur beruht, ist dynamischer, was allerdings auch bedeutet, dass er nicht immer viel bewahrt.
Man kann den rechten Amerikanern nur sehr schwer klarmachen, wie kompliziert es ist, unter den Bedingungen des Hyperkapitalismus irgendetwas zu bewahren oder zu erhalten. Einer der Gründe, warum die Republikaner des Establishments Trump hassten, ist, dass er die Globalisierung infrage stellte. Eine wahrhaft konservative Gesellschaft sollte dem freien Markt meiner Ansicht nach Grenzen setzen, um das, was eine gute, wirklich menschliche Gesellschaft braucht, zu schützen und zu bewahren. Es kommt nicht von ungefähr, dass die englischsprachige Welt Veränderungen wie zum Beispiel die Leihmutterschaft schneller akzeptiert hat als das kontinentale Europa.
WELT: Die von Ihnen so vehement geforderte Neuverzauberung der Welt scheint allerdings mit dem Progressismus nicht vereinbar zu sein, da es sich darin um eine Form des Materialismus handelt. Kann man also auch nicht Christ und gleichzeitig progressiv sein?
Dreher: Die Art von Neuverzauberung der Welt, von der ich rede, ist mit der progressiven Ideologie nicht vereinbar, denn dafür ist die Anerkennung einer transzendenten Ordnung erforderlich, ebenso wie von einem Sinn und Zweck, der vorgegeben ist und nicht erst erschaffen wird. Die Progressiven wollen eine Gesellschaft formen, in der die Menschen „frei“ sein werden, was sie ihrer Ansicht nach glücklich machen wird, und zwar dadurch, dass sie jede Existenz einer Ordnung oder Grenze verleugnen. Dabei wollen sie immer wieder neue Hindernisse erfinden, die es zu überwinden gilt, damit sie endlich frei von jeder „Unterdrückung“ sein können. Milan Kundera sagte einmal über sie, dass sie sich gern als Mitglieder eines Großen Marsches der Geschichte Richtung Utopie sehen würden.
Wir im Westen lehnen mittlerweile Gott, die Transzendenz und jegliche andere Autorität als das Selbst ab. Doch wozu hat uns das geführt? Wir sind unglücklich, unbedeutend und verloren. Lesen Sie die Romane von Michel Houellebecq, der das nihilistische Unbehagen unserer Zeit genau erkannt hat. Der US-amerikanische Sozialkritiker Philip Rieff war ebenfalls Atheist, hat aber erkannt, dass keine Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit überdauern kann, wenn sie die Transzendenz leugnet. Dann ist sie nicht zukunftsfähig.
WELT: Wenn der Materialismus also nicht von langer Dauer sein kann – da die Menschheit, wie Sie annehmen, mit einer zu großen Dosis an Entzauberung nicht überleben kann – welche Perspektiven sehen Sie dann?
Dreher: Ich glaube, dass die älteren Katholiken immer noch glauben wollen, dass das Christentum in der Gesellschaft im Allgemeinen eine wichtige Rolle spielt, und wir auch anerkannt werden, wenn wir den Glauben nur weiterhin modernisieren und uns den Regeln der Welt anpassen. Doch die jungen Katholiken haben sich bereits mit der Tatsache abgefunden, dass die moderne Welt das Christentum ablehnt. Deshalb versuchen sie eher herauszufinden, wie man unter diesen Bedingungen ein wirklich christliches Leben führen kann. Wenn das Christentum im Westen überhaupt noch eine Zukunft hat, dann dank dieser Christen – Geistliche und Laien – die vor allem nach dem Reich Gottes streben.
Vor hundert Jahren meinte der englische katholische Denker Hilaire Belloc: „Europa ist der Glaube, und der Glaube ist Europa“. Ich glaube, dass das zutrifft. Wenn Europa nicht sein ursprüngliches Christentum wiederfindet, wird es als eigenständige Zivilisation nicht überleben. Sicherlich werden nach wie vor Menschen auf den Gebieten leben, die wir „Europa“ nennen, aber das Wort „europäisch“ wird sich nur noch auf eine geografische Adresse beziehen und nicht mehr auf eine Geisteshaltung oder eine bestimmte Lebensweise. Und das wäre eine ungeheure Tragödie.
WELT: Inwiefern ist Trump kein „guter Christ“, wie Sie erklärt haben?
Dreher: Nun ja, es gibt in seinem Leben recht wenig, was für einen christlichen Glauben und ein dementsprechendes Engagement sprechen würde! Er war nie ein wirklich praktizierender Christ, kennt die Bibel nicht und seine zahlreichen Affären sind ja nun wohlbekannt. Es heißt, Martin Luther habe gesagt: „Ich würde lieber von einem weisen Türken regiert werden als von einem dummen Christen.“ Ich als US-amerikanischer Christ ziehe es immer noch vor, von einem schlechten Christen wie Trump regiert zu werden, der zumindest gewisse politische Ziele verfolgt, die mit den christlichen Lehren vereinbar sind, als von einem dummen Christen wie Joe Biden, der zwar in den Gottesdienst geht, gleichzeitig aber den Wokismus verteidigt.
Dennoch muss ich sagen, dass es immer schwieriger wird, Trump zu unterstützen. Ich verstehe nicht, warum er Europa mit derartig gnadenlosen Zöllen attackiert. Das beweist, dass ein Christ ganz allgemein das, was der 146. Psalm sagt, nie aus den Augen verlieren darf: „Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen“.
WELT: Vor wenigen Tagen hat Papst Franziskus uns verlassen. Was bleibt Ihrer Ansicht nach von seinem Vermächtnis und seinen Reformen?
Dreher: Alles hängt davon ab, wer der nächste Papst sein wird. Im Allgemeinen glaube ich jedoch nicht, dass von den Reformen von Papst Franziskus viel zurückbleiben wird. Sie waren so chaotisch und, wie es scheint, auch nicht sonderlich populär. Franziskus war der letzte Seufzer der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also der Kirche der Generation der 1960er-Jahre. Sie ist den heutigen Herausforderungen nicht gewachsen. In den Vereinigten Staaten hatte das Pontifikat von Franziskus so gut wie keinen Einfluss auf die Zahl der Berufungen zum Priesteramt. Im Gegenteil: Rund 80 Prozent der während seines Pontifikats geweihten Priester bezeichnen sich selbst als theologisch orthodox.
Das bedeutet zwar nicht, dass die US-amerikanischen Katholiken konservativer geworden sind, denn das ist nicht der Fall. Es zeigt jedoch, dass die Jugendlichen, die ihr Leben der Kirche weihen – und das in einer Zeit, in der die meisten Gleichaltrigen sich eher von der Kirche abwenden – nicht vom Progressismus, sondern von der Tradition dazu inspiriert werden.
Ich glaube, dass das Pontifikat einen Wendepunkt in der Geschichte der Kirche bedeutet, allerdings nicht im positiven Sinne. Sein Vermächtnis wird weder theologisch noch kirchlicher Natur sein; seine Reformen widersprechen zu sehr der katholischen Tradition, um überdauern zu können. Sein Vermächtnis ist eher, dass er das Papsttum destabilisiert hat. Wenn ein so chaotischer Mensch wie Bergoglio zum Papst gewählt werden kann, dann könnte das auch wieder passieren. Die Rolle des Papstes sollte eigentlich die eines soliden Felsens der Orthodoxie sein. Nun wissen die Katholiken jedoch, dass dem nicht so ist. Das kann man weder ignorieren noch vergessen. Und es ist etwas sehr Wichtiges.
Dieser Artikel erschien zuerst bei „Le Figaro“, wie WELT Mitglied der Leading European Newspaper Alliance (Lena). Übersetzt von Bettina Schneider.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.