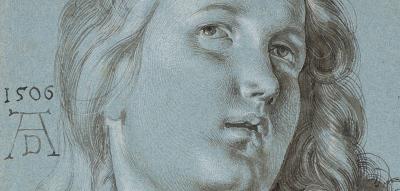Wie haben sie uns nur zugerichtet?“ Wird das Vögelchen in seiner Hand gefragt und bekommt den Hals erst zugedrückt und dann umgedreht. Eine rhetorische Frage, eine Antwort war nicht erwartet. Eugen Hinkemann, der versehrte Kriegsrückkehrer, hat selbst gelitten wie ein misshandeltes Tier. Ein räudiger Hund sei er, sagt er. Er sagt auch: „Armes Volk ist schlechter dran als Vieh.“ Da geht es ihm nicht anders als Tausenden und Abertausenden, ein Massenschicksal. So drastisch wie in Ernst Tollers 20er-Jahre-Drama „Hinkemann“ sieht man die seelischen Verheerungen des Krieges selten auf der Bühne. Am Deutschen Theater Berlin wird es neu inszeniert, eine Wiederentdeckung!
Der Autor des Stückes, Ernst Toller, war im Ersten Weltkrieg selbst Frontsoldat gewesen und hat nach eigenem Bekunden zeitlebens nicht begreifen können und wollen, welches Leid der Mensch dem Menschen zufügen kann. Es trieb ihn, nach den Ursachen der Schlachterei zu suchen, und so kam er darauf, dass der staatlich erlaubte und erwünschte Totschlag nicht möglich sei ohne das handfeste Interesse der Staaten, in der Konkurrenz um Ressourcen, Absatz und Profit die Nase vorn zu haben. So kam es, dass Toller zum Kriegsende als einer von vielen Dichtern in der Münchner Räterepublik versuchte, einen anderen Staat und eine andere Produktionsweise durchzusetzen.
Bekanntlich scheiterte der Versuch nicht nur, sondern wurde – keine Experimente! – brutal bestraft, wobei Toller mit mehrjähriger Festungshaft noch gut davonkam. In seiner Haft schrieb er nicht nur sein berühmtes Stück „Masse Mensch“, ein expressionistischer Klassiker, sondern auch „Hinkemann“: die Geschichte eines Mannes, der seine Männlichkeit – metaphorisch und unmetaphorisch – auf dem Schlachtfeld verloren hat. Der Krieg als Vater aller Dinge? Für Toller wird in den Stahlgewittern kein neuer Mensch geboren, es geht nur die Menschlichkeit zugrunde. Und zwischen Giftgaswolken und Panzerschlachten ist der Einzelne nur noch ein Stück Material, aber kein Held mehr.
„Alles wankt.“
Während die Bundesrepublik nun wieder „kriegstüchtig“ werden soll, zeigt „Hinkemann“ eine Gesellschaft, die durch den Krieg lebensuntüchtig geworden ist. Moritz Kienemann als Eugen Hinkemann ist ein geschlagenes Tier, das von den Schlachtfeldern in die Städte gekrochen kam. Ein Verlorener, dem auch die Fortschrittsversprechen der sozialdemokratischen Saufbrüder am Stammtisch nicht mehr helfen können. Ein Schrei der beschädigten Subjektivität, die wie eine Wunde offenliegt, weil der Krieg jeden Reizschutz zerschossen hat. Entfremdet vom Zivilleben, kommt ihm ein Lachen wie eine Gewehrsalve vor. Nichts ist mehr im Lot. Oder in Hinkemanns Worten: „Alles wankt.“
Der Verlust an Halt spiegelt sich in der grellgrünen Wohnzelle, die Bühnenbildnerin Judith Oswald vor den großen roten Vorhang gestellt hat: die Wände schief, der Boden abschüssig. Die Enge kontrastiert die himmelweite Entfremdung, die zwischen Hinkemann und seinen Nächsten herrscht. Da ist die von Lorena Handschin großartig gespielte Grete Hinkemann, die an der männerlosen Heimatfront den Hunger aufs Leben entdeckt hat, oder der von Jeremy Mockridge gespielte Paul Großhahn, der mit auftrumpfendem Gehabe Grete verführt. Sie wollen – wie verstümmelt auch immer – noch etwas vom Leben, das Hinkemann ein „Ersatzleben, Maschinenleben“ nennt.
Der Krieg ist bei Toller in alle Ritzen des Lebens eingedrungen, sogar dort, wo man ihn am wenigsten vermuten würden: in die Unterhaltung. Auf dem Rummel verdingt sich Hinkemann durch grausige Tierquälerei. „Kultur ist vorbei“, wird er von dem auf einer Rakete posierenden Budenbesitzer (Jonas Hien) über die neue Kulturindustrie belehrt. „Heute verdienen wir am Blut.“ So ist der Übergang zur grotesken Propagandashow fließend. Wenig später tanzen die Horrorpuppen der künftigen Barbarei – Kostüme von Daniela Selig – zu Schlagzeilen über die Bühne, ihre digitalen TikTok-Wiedergänger gesellen sich auf der Leinwand dazu: Vergangenheit und Gegenwart überlagern sich.
Regisseurin Anne Lenk, die vor knapp über zehn Jahren in München bereits Tollers Gesellschaftssatire „Hoppla, wir leben!“ auf die Bühne brachte und seit langer Zeit am Deutschen Theater Berlin mit ihren Arbeiten begeistert, und ihr beeindruckendes Ensemble bringen eine Intensität auf die Bühne, die man nicht vergessen wird. Zudem sich hier – ganz konservativ, könnte man sagen, weil mit den Mitteln des literarischen, psychologischen Schauspiels – eine Schicht des menschlichen Daseins erschließt, die sich allen Parolen und diskursiven Verwurstungen entzieht. „Wo die Worte aufhören, fängt die Not erst an“, bringt Hinkemann dieses kreatürliche Leiden auf den Punkt.
Weil es für das, wie Hinkemann zugerichtet wurde oder sich selbst zugerichtet hat, keine Sprache gibt, wird ihm umso verdächtiger, was an die Stelle dieses Mangels tritt: das überdrehte Lachen einer zutiefst verzweifelten Gesellschaft. Man kann sagen, dass Toller bereits 1922 ahnte, was unter der unterhaltungssüchtigen Oberfläche der Goldenen Zwanziger brodelte. „Der Krieg ist wieder da“, heißt es bei ihm. „Die Menschen morden sich unter Gelächter.“ Gibt es bei so viel Verzweiflung noch Hoffnung? Ja, gibt es. Der neue Mensch, der vielleicht nicht alles zwanghaft in Stücke haut, wird am Ende aus dem Geist der Wahlverwandtschaft geboren, nicht im Krieg der Zwangskollektive.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.