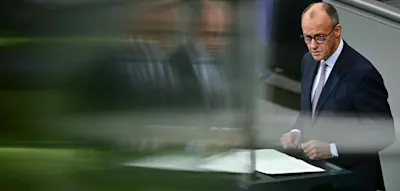Die Stimmung in der Nato war angespannt. Es ging um zwei zentrale Fragen an diesem Mittwoch: Was tun, um die Ukraine stärker zu unterstützen? Und: Wie lässt sich angesichts von zahlreichen Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und Kampfjets in den vergangenen Wochen die Luftabwehr insbesondere an der sogenannten Ostflanke der Allianz deutlich verbessern?
Ein Grund für die Nervosität der Nato-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel waren vor allem nationale Befindlichkeiten bei der geplanten Luftraumverteidigung – und wieder einmal das Geld. „Unsere Erwartung heute ist, dass mehr Länder noch mehr ausgeben, dass sie noch mehr kaufen, um die Ukraine zu versorgen und diesen Konflikt zu einem friedlichen Abschluss zu bringen“, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zu Beginn des Treffens.
Hegseth forderte die Verbündeten auf, die Investitionen in das Programm mit dem etwas sperrigen Titel „Vorrangige Bedarfsliste für die Ukraine“ (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL) zu erhöhen. Das Programm hat die bisherige amerikanische Hilfe für die Ukraine ersetzt. Nunmehr sollen die Europäer und Kanada in den USA hergestellte Munition und Waffen kaufen – und diese dann der Ukraine zur Verfügung stellen.
Gleichzeitig forderte Hegseth von Russland ein schnelles Ende des Kriegs in der Ukraine – und verband dies mit einer Drohung in Richtung Moskau. Sollte kurzfristig kein Weg zum Frieden gefunden werden, würden die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten Russland für seine fortgesetzte Aggression zur Rechenschaft ziehen, sagte er. „Wenn wir diesen Schritt tun müssen, ist das US-Kriegsministerium bereit, seinen Teil auf eine Weise beizutragen, wie es nur die Vereinigten Staaten können“, so Hegseth. Dies könnte als Hinweis auf die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit großer Reichweite verstanden werden. Ein Thema, das voraussichtlich auch beim Treffen von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Donald Trump am Freitag besprochen wird.
Washington hatte zuletzt klargemacht, keine weiteren Gelder für die Unterstützung des angegriffenen Landes ausgeben zu wollen. Trump ist der Ansicht, dass Amerika in der Vergangenheit im Vergleich deutlich mehr für die Ukraine getan hat als andere Nato-Länder. Nun sollen die Alliierten für weitere US-Militärhilfen zahlen.
Der PURL-Mechanismus war im Juli zwischen Trump und Nato-Chef Mark Rutte ausgehandelt worden. Es geht dabei vor allem darum, Luftabwehrsysteme wie Patriots und Munition aus US-Beständen an die Ukraine weiterzuschicken. Insbesondere Frankreich ist unzufrieden damit, dass mit europäischem Geld die amerikanische Rüstungsindustrie unterstützt werden soll.
Auch in Deutschland gibt es Vorbehalte, Beträge in Milliardenhöhe auf US-Konten zu überweisen, die dann der europäischen Wirtschaft fehlen. Andererseits ist der Bundesregierung klar: Es gibt zu diesem Geschäft derzeit keine Alternative. Denn es geht bei den Käufen in den USA vor allem um Waffen, die in Europa nicht produziert werden oder nicht vorrätig sind.
Unterstützung für die Ukraine bricht ein
Rutte forderte bei dem Treffen ebenso wie Hegseth weitere Gelder für Waffenkäufe zugunsten der Ukraine. Er hatte allen Grund dazu: Laut dem neuesten Ukraine Support Tracker des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel sind die Militärhilfen der Europäer für die Ukraine in diesem Sommer eingebrochen: Im Juli und August sank das monatliche Durchschnittsniveau – einschließlich der Waffenkäufe in den USA – um 57 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025.
„Das ist kritisch“, sagte Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson. „Wir sehen, dass man bei der Unterstützung der Ukraine den falschen Pfad eingeschlagen hat. Es geht runter, aber wir wollen es hochgehen sehen.“ Insgesamt 3,5 Milliarden Dollar hatte Selenskyj bis Oktober an Waffenkäufen aus den USA erbeten – bis August kamen aber nur 1,9 Milliarden Euro zusammen.
Die Liste der von der Ukraine nachgefragten Waffen ist geheim. Nur sechs Nato-Länder machten zu Beginn bei der PURL-Initiative mit. Mittlerweile sind es laut Rutte „mehr als die Hälfte der Allianz-Mitglieder“. Ob auch Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien inzwischen dabei sind und wie viel sie gegebenenfalls beisteuern wollen, ließ er jedoch offen. Der interne Druck auf diese vier Länder war groß, genauso wie der Unmut über ihre monatelange Weigerung, solidarisch zu sein.
Berlin stellte bereits recht früh 500 Millionen Euro für Waffenkäufe aus den USA zur Verfügung, ebenso die Niederlande. Auch Schweden, Norwegen und Dänemark finanzierten ein Paket von 500 Millionen Euro. Die Gesamtsumme von 1,9 Milliarden Euro seit Juli liegt trotzdem weit hinter den Erwartungen und Bedürfnissen Kiews. Allerdings dürften sich die Zusagen direkt im Anschluss an das Treffen der Verteidigungsminister weiter erhöhen.
Putin hofft, dass Europa das Geld ausgeht
Das Gezerre um den PURL-Mechanismus ist symptomatisch: Vielen Nato-Ländern fällt es wegen eines wachsenden Unmuts in der eigenen Bevölkerung, aber insbesondere wegen der leeren Staatskassen immer schwerer, die Ukraine stetig mit hohen Millionenbeträgen zu unterstützen. Genau darauf setzt Russlands Machthaber Wladimir Putin, der mittlerweile eine florierende Kriegswirtschaft im eigenen Land aufgebaut hat.
Gleichzeitig setzt der Kreml immer stärker auf hybride Kriegsführung – militärische und nicht militärische Maßnahmen, die sich unterhalb der Schwelle einer offenen Auseinandersetzung bewegen. Dazu gehören neben Sabotageakten von staatlichen Akteuren, Cyberangriffen oder Desinformation auch zunehmend Luftraumverletzungen durch Drohnen wie Mitte September in Polen oder Kampfjets (MiG-31) wie in Estland.
Die Nato ist vor allem von dem Drohnenschwarm in Polen überrascht worden, musste dabei feststellen, dass die eigene Aufklärung die Fluggeräte viel zu spät erkannt hatte und zudem keine angemessene und kostengünstige Flugabwehr zur Verfügung stand. Das soll sich nun schnellstens ändern. Bereits unmittelbar nach dem Vorfall hatte die Nato einen neuen Einsatz zur besseren Überwachung des Luftraums der Ostflanke von der Ostsee bis zum Mittelmeer bekannt gegeben, der „Eastern Sentry“ (Östlicher Wachtposten) heißt.
Er soll nach Angaben aus Nato-Kreisen zu einer Art „Blaupause“ für die künftige integrierte Luftverteidigung in anderen Regionen des Bündnisses werden. Allerdings beteiligen sich bisher nur neun Mitgliedstaaten. Deutschland wird mindestens zwei zusätzliche Eurofighter zur östlichen Luftraumüberwachung beisteuern, ebenso wie Großbritannien. Dänemark schickt zwei F-35-Kampfjets, die USA beteiligen sich bisher nicht.
Die große Frage, die derzeit hinter den Kulissen der Nato diskutiert wird, lautet: Wie lassen sich an der rund 5000 Kilometer langen Ostgrenze des Bündnisses zu Russland die Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten so verbessern, dass Moskau von einem Angriff auf die Nato ausreichend abgeschreckt wird – oder mögliche russische Angriffe rechtzeitig vereitelt werden können?
Nach Angaben von Nato-Diplomaten will der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, US-General Alexus Grynkewich, die Alliierten dazu bringen, nationale Einschränkungen für die Beteiligung ihrer Streitkräfte an Nato-Einsätzen so weit wie möglich aufzuheben. So könnten nationale Bestimmungen etwa vorsehen, dass Kampfjet-Piloten sich nicht an Abschussmanövern beteiligen oder nur in bestimmten Lufträumen fliegen dürfen.
„Je mehr nationale Vorbehalte es gibt, vor allem für Kampfjets, desto schwieriger wird es für den Oberbefehlshaber“, sagte Amerikas Nato-Botschafter Mathew G. Whitacker. Aber es ist nicht immer ohne Weiteres möglich, die bisher geltenden Regeln zu ändern – in Deutschland wäre dafür etwa ein Beschluss des Bundestags nötig. Und ob Spanien, wo eine ultralinke Partei an der Regierung beteiligt ist, mitmachen würde, ist alles andere als sicher.
Kämpfe in der Ostukraine halten an
Die Nato-Militärs sind sich allerdings einig darin, dass man die gesamte Ostflanke mit den bisherigen Mitteln nicht so lückenlos überwachen kann, wie es nötig wäre. Darum will das Bündnis künftig hochkomplexe Drohnenplattformen einsetzen. Sie sollen anfliegende Objekte mithilfe von Akustik-Sensoren rechtzeitig erkennen, sie verfolgen und notfalls neutralisieren. „Das wird zu einem großen Teil auch ein autonomes Waffensystem sein, wie es bereits in Israel und der Ukraine zum Einsatz kommt“, sagte ein Nato-Militär WELT.
Aber auch in diesem Fall stellt sich neben zahlreichen anderen Problemen die Frage, woher das Geld für die neuen Milliarden-Investitionen kommen soll. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte am Mittwoch an, zehn Milliarden Euro für die Beschaffung von Drohnen aller Art in den kommenden Jahren ausgeben zu wollen. Eine Ansage, mit der Deutschland auch andere Nato-Länder wachrütteln will. Ob das gelingen wird, ist offen.
Während die 32 Nato-Verteidigungsminister stundenlang in abhörsicheren Räumen in Brüssel tagten, gingen die Kämpfe vor allem im Osten der Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Auch wenn Moskaus Sommeroffensive gescheitert ist, hat sich Russland nach Einschätzung des renommierten Militärstrategen Oberst Markus Reisner vom Verteidigungsministerium in Wien an bestimmten Frontabschnitten in eine günstige Position gebracht.
Nach internen Angaben der Nato werden derzeit jeden Tag etwa 900 russische Soldaten getötet oder verletzt, deutlich weniger als noch im Frühjahr und in den ersten Sommermonaten. Es wird davon ausgegangen, dass das seit Monaten umkämpfte Pokrowsk in der Oblast Donezk mittelfristig fallen könnte, was Moskau anschließend erhebliche Geländegewinne ermöglichen würde. Die Städte Siwersk und Kupjansk sind ebenfalls akut bedroht. Von dort könnte Russland dann die kommende Frühjahrsoffensive planen.
In der Nacht zum Mittwoch hat Moskau zudem die ukrainische Energieinfrastruktur erneut mit Drohnen angegriffen und dadurch in sieben Regionen die Stromversorgung unterbrochen. Die Nato beobachtet diese Angriffe auf kritische Infrastruktur mit großer Sorge. Ein hoher Nato-Diplomat sagte am Dienstag, seit geraumer Zeit hätten die „russischen Drohnen eine erhöhte Effektivität“. Sie könnten höher fliegen, sie kämen in kürzeren Abständen und in größerer Zahl.
Damit würde die ukrainische Luftabwehr häufig „übersättigt“, so der Beamte. „Der Rhythmus hat sich beschleunigt“, führte er aus. „Russland hat sich bei der Drohnenentwicklung angepasst und enorm aufgeholt. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre nicht so, aber: Russland hat einen professionellen Ansatz und zieht die richtigen Lehren aus dem Konflikt.“ Insgesamt verfüge Moskau heute über „fähigere Streitkräfte“ als vor Beginn des Krieges.
Christoph B. Schiltz ist Korrespondent in Brüssel. Er berichtet unter anderem über Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, die europäische Migrationspolitik, die Nato und Österreich.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.