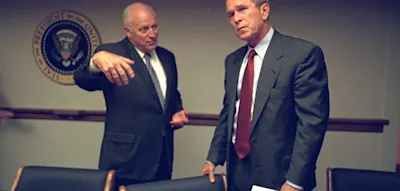Am letzten Wochenende im Oktober ähnelt die Stimmung im Forest Hills Stadium einem Festival. Wo ehemals die US Open stattfanden, schwenken junge Leute Poster ihres Stars und verteilen Flyer. Die New Yorker Polizei hat die Straßen weiträumig abgesperrt. Dabei ist der Grund für die Großveranstaltung kein Popkonzert oder sportliches Großereignis.
Es ist die anstehende Bürgermeisterwahl. Fast zwei Stunden muss das Publikum ausharren, bis Zohran Mamdani unter Jubelstürmen auf die Bühne kommt. Bis dahin haben Gewerkschaftsmitglieder, eine Komikerin, ein Imam und schließlich die Linken-Ikonen Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez den Zuschauern eingeheizt, die zu Tausenden in den Stadtteil Queens gepilgert sind.
Hunderte Handy-Taschenlampen leuchten in den New Yorker Abendhimmel, Drohnen fliegen, die Redebeiträge von Mamdani und seinen Unterstützern werden alle paar Sätze von lauten „Wuuuhs“ und „Yeahs“ unterbrochen.
Zohran Mamdani ist der neue Star der Demokraten. Selten in New Yorks Geschichte hat eine Bürgermeisterwahl so viel Aufsehen erregt. Vergangenen Herbst begann der 34-Jährige die große politische Bühne zu erobern. „Wir können alles erreichen, und noch viel mehr. Das hier ist New York. Wir können es uns leisten, zu träumen!“, erklärte Mamdani seinerzeit in seinem Bewerbungsvideo.
Der Mann, der die besten Chancen für den Sieg am 4. November hat, besitzt wenig vom Prototypen eines amerikanischen Politikers. Bei seinen Auftritten trägt er wahlweise Anzug, Hoodie oder Kurta, ein traditionelles langes Hemd.
Mit einer Mischung aus sprühendem Optimismus und knallhart alltagsnahen und populistischen Forderungen hat der Lokalpolitiker einen atemberaubenden Aufstieg hingelegt. Geboren wurde er in Uganda als Sohn eines indischen Politologen und einer indischen, Oscar-nominierten Regisseurin. Seine Jugend verbrachte er in Manhattan, in den Morningside Heights an der Upper West Side, ein von Akademikern und Gutverdienern bevölkertes Viertel.
Erst vor fünf Jahren stieg er als Abgeordneter der New York State Assembly in die aktive Politik ein. Kommende Woche könnte er Bürgermeister einer der kulturell wichtigsten Metropolen der Welt sein. Sein Geheimnis? Er habe Trump-Wähler in New York gefragt, warum sie bei der letzten Wahl ihre Stimme dem Maga-Präsidenten gegeben hätten. „Die Antwort lautete immer wieder: Das Leben in New York ist zu teuer.“
Sozialistischer Populismus
Mieten, Kinderbetreuung, Lebensmittel – der Big Apple ist für einen großen Teil der New Yorker unerschwinglich geworden. Während die Mieten schon im günstigsten Stadtteil Queens im Durchschnitt bei 3466 Dollar liegen, sind sie laut Marktforschungsunternehmen Rental Real Estate in Manhattan auf 4500 Dollar angestiegen – viermal so hoch wie im Landesschnitt.
Von Teilen der Demokraten und einigen Medien wird Mamdani bereits als Nachwuchshoffnung für die Partei gefeiert. Aber ist der gläubige Muslim auch außerhalb des in großen Teilen linksliberalen New Yorks ein mehrheitsfähiger Kandidat? Er selbst bezeichnet sich als „demokratischen Sozialisten“. Seine Einstellung zu Israel und militantem Islamismus wirft indes Fragen auf. Zumal bei fast einer Million Juden, die in New York leben.
Auf nationaler Ebene verfolgen Mamdanis Genossen den Aufstieg des charismatischen Mannes ebenfalls mit großer Aufmerksamkeit – und Skepsis. Angesichts der Misere der Demokraten im komplett von Donald Trump dominierten Politikbetrieb gilt Mamdanis Wahlkampf als Paradebeispiel, wie Wähler durch intensiven Straßenwahlkampf und eine brillante Social-Media-Kampagne mobilisiert und gewonnen werden können.
Zugleich kann Mamdani jedoch auch eine Gefahr für die Demokraten sein. Der Begriff „Sozialist“ verschreckt weite Teile der US-Wählerschaft. Laut Umfragen lehnt eine Mehrheit Sozialismus kategorisch ab, vor allem die ältere Generation. „Deshalb scheuen sich so viele führende Demokraten, Mamdani öffentlich zu unterstützen. Abgeordnete fürchten, dass sie bei zu großer Nähe zu ihm bei den nächsten Wahlen ihren Sitz verlieren könnten“, sagt Lanae Erickson, Expertin der sozialdemokratischen Denkfabrik Third Way.
Doch Mamdanis Wahlversprechen verfangen – weil sie simpel sind: Mietendeckel, höhere Löhne, kostenlose Verkehrsmittel und gute Gesundheitsvorsorge für alle. Auf der Bühne des Forest Hills Stadions lässt Mamdani seine Fans die Slogans rufen, die sie hier auswendig können. „Wir wollen kostenfreie…“, setzt Mamdani beispielsweise an – dann schallt ihm ein tausendfaches „Busse“ entgegen.
Finanzieren will Mamdani das alles durch höhere Steuern für Gutverdiener und Unternehmer – entsprechend groß ist der Widerstand im Wirtschaftslager und bei den Konservativen. Milliardäre wie Bill Ackmann oder Michael Bloomberg werden im New Yorker Stadion ausgebuht, als sie erwähnt werden. „Die Milliardäre interessieren sich nicht für hart arbeitende New Yorker“, sagt Mamdani.
Ackmann und Bloomberg spenden derweil an Andrew Cuomo, den einzigen Gegenkandidaten mit einer gewissen Chance – wenn er durch ein Wunder den Rückstand von 15 Punkten binnen weniger Tage wettmachen kann. Mamdanis linker Populismus kommt besser an als alle Alternativen. Er hat keine Scheu, sich als „demokratischen Sozialisten“ zu bezeichnen.
Was in anderen Teilen der USA undenkbar wäre, hat in New York Tradition. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war der „Big Apple“ das amerikanische Zentrum der linken Bewegungen. Immer wieder gab es hier Politiker, die einen von sozialistischen Ideen geprägten Wahlkampf führten. Bis in ein Regierungsamt schaffte es bisher aber niemand.
Überzogene Israelkritik und Nähe zu Islamisten
Was bei der Wahlkampf-Show im Forest Hill Stadion auffällt: Nicht bei den Forderungen nach stabilen Mieten etwa sind die Jubelrufe am lautesten. Sondern dann, wenn Mamdani und seine Unterstützer Gaza ansprechen. Man dürfe sich nicht davor fürchten, von einem Genozid im Nahen Osten zu sprechen, fordert eine Vertreterin der Demokratischen Sozialisten auf der Bühne beispielsweise.
Was Musik in den Ohren des linken und muslimisch geprägten Publikums in New York ist, verstört wiederum andere. Vielen geht das, was Mamdani und seine Bewegung fordern, weit über legitime Israelkritik hinaus. Erst kürzlich konnte er in einem TV-Interview die Frage, ob die Hamas im Gaza-Streifen die Waffen ablegen soll, nicht mit „Ja“ beantworten.
Vor einigen Tagen dann sorgte ein Foto für Aufsehen. Mamdani posierte lachend mit Siraj Wahhaj, Imam in einer New Yorker Moschee. Der 75-jährige Wahhaj, der auch Vorsitzender der Muslim Alliance in North America ist, wurde einst von der New Yorker Staatsanwaltschaft als „nicht angeklagter Mitverschwörer“ des Bombenanschlags auf das World Trade Center 1993 bezeichnet, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen.
Wahhaj wiederum bestreitet jede Verbindung zum Terrorismus, eine Beteiligung an der Tat wurde nie nachgewiesen. In seinen Predigten fiel er immer wieder durch homophobe Aussagen auf. Brad Lander, Mamdani-Unterstützer und New Yorks oberster Rechnungsprüfer, der ebenfalls im Forest Hill Stadion spricht, tut die Berichterstattung darüber als „widerliche Islamfeindlichkeit“ ab – woraufhin die Menge jubelt.
Inhaltlich gehen weder Lander noch Mamdani auf die Vorwürfe ein. Und auch die Partei, für die er einst als Kandidat antrat, wirft Fragen auf. Die Democratic Socialists of America (DSA) präsentieren sich als soziale Bewegung – haben aber vor allem durch das Thema Nahost Zulauf.
In einem Post auf „X“ fordert das Bündnis unlängst die Freilassung von „politischen Gefangenen“, darunter Elias Rodriguez. Der 31-jährige Mann aus Chicago hatte im Mai in der Nähe des Capital Jewish Museum in Washington das Feuer auf eine Veranstaltung eröffnet und tötete zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft: Yaron Lischinsky, ein Deutsch-Israeli, und Sarah Milgrim, eine amerikanische Jüdin.
Nach seiner Festnahme soll Rodriguez „Free Palestine“ und „Ich habe es für Gaza getan“ gerufen haben. Zwar änderte Mamdani zuletzt den Ton seiner Israelkritik. Am zweiten Jahrestag des 7. Oktober nahm er demonstrativ an einer Gedenkveranstaltung teil.
Doch Teilen der demokratischen Wählerschaft, die die Partei zurückgewinnen muss, bleibt er suspekt. „Er steht auch immer noch in Verbindung mit den Democratic Socialists of America und hat sich nicht von ihnen distanziert. Deren Programm ist weitreichend und politisches Gift“, sagt die Politikexpertin Erickson. „Bisher hat er da nicht genug getan. Aber er entwickelt sich in Echtzeit weiter.“
Stefanie Bolzen berichtet für WELT seit 2023 als US-Korrespondentin aus Washington, D.C. Zuvor war sie Korrespondentin in London und Brüssel. Jan Klauth ist US-Korrespondent mit Sitz in New York.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.