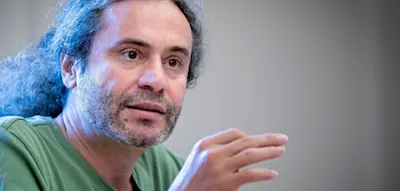Als WELT Mohammed Duda im Juli zuletzt anrief, musste er das Telefonat zweimal abbrechen. „Die RSF greift an“, schrieb er per WhatsApp, „ich melde mich, wenn es ruhiger ist.“ Später nur noch: „Drohnen am Himmel.“ Es war sein Alltag in der Stadt Al-Faschir, der letzten Bastion der sudanesischen Armee in Darfur, einer Region im Westen des Sudans mit einer größeren Fläche als Deutschland. Hunderte Male wurde der Ort seit April 2024 von den Rapid Support Forces (RSF) angegriffen. Systematisch hatte die Miliz den Ort von jeglicher Lebensmittelversorgung abgeschnitten, Hunger als Waffe eingesetzt.
Der gelernte Ingenieur Duda, 40, war einer der Wortführer seiner verfolgten Ethnie, den Massalit, die im Zuge des Bürgerkrieges fast vollständig von der RSF aus Darfur vertrieben wurde. Oder getötet. Er versuchte, den verzweifelten Überlebenskampf inmitten dieser Blockade zu dokumentieren. Über Interviews und Fotos wollte er endlich internationale Aufmerksamkeit erzeugen für die Vorgänge in Darfur, die von den USA Anfang des Jahres offiziell als Genozid eingestuft worden sind. Das schaffte er nur zum Teil.
Am 26. Oktober wurde Mohammed Duda getötet. Seine Freunde bestätigten WELT, dass er bei den letzten Gefechten um die Stadt starb, als die Armee ihre Stellungen abzog und die RSF Al-Faschir einnahm. Seither sind Satellitenbilder von Massengräbern und großflächigen Blutlachen im Umlauf. Dazu kursieren Aufnahmen von massenhaften Exekutionen durch die RSF, die sich in den sozialen Medien weit verbreiteten und auch in westlichen Ländern für Entsetzen sorgten.
Erstmals seit Kriegsbeginn entsteht so etwas wie öffentlicher Druck auf die mit Abstand wichtigsten internationalen Unterstützer der RSF: die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), deren Waffenlieferungen über Flugroutendaten, Satellitenbilder und Seriennummern von in Darfur sichergestellten Waffen laut UN-Berichten weitgehend belegt sind.
Zwei Tage nach dem Fall von Al-Faschir berichtete das „Wall Street Journal“ über mehrere US-Geheimdienstberichte, die dem Blatt zufolge „einen zunehmenden Zustrom“ von Kriegsgütern durch die VAE seit dem Frühling beschreiben, darunter moderne Drohnen.
Seitdem bemühen sich sowohl die RSF als auch die VAE auffällig um bessere Propaganda. Die RSF kündigte Ermittlungen gegen Kämpfer aus den eigenen Reihen an und verbreitete Aufnahmen der Verhaftung von einem ihrer Kommandeure, Abu Lulu. Er war bei zahlreichen Exekutionen gefilmt worden – und hatte in einem der Videos geprahlt, 2000 Menschen getötet zu haben.
Die Interessen der Emirate im Sudan sind vielfältig. Sie hatten vor dem Krieg Milliarden in Landwirtschaft und Rohstoffhandel investiert. Besonders in Darfur kontrolliert die RSF große Goldvorkommen. Ein Großteil der Erlöse landet, wie Analysten betonen, über die Finanzmärkte Dubais im internationalen Umlauf. Die RSF hatte den Emiraten zudem einst Zehntausende Söldner im Jemen-Krieg an die Seite gestellt. Wenig überraschend schlug sich das Land mit Ausbruch der Kämpfe auf die Seite der Miliz. Zumal bei deren Kriegsgegner, Sudans Streitkräften, der VAE-Feind Iran an Einfluss gewinnt.
Die VAE dementieren ihre Kriegsbeteiligung im Sudan nun noch häufiger. Vor einigen Tagen brachte die RSF dann ein Fernsehteam nach Al-Faschir, und zwar von dem Sender „Sky News Arabia“, der zur Hälfte dem Vizepräsidenten der VAE gehört, Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dass die zuständige Reporterin eine RSF-Kommandeurin umarmte, die zuvor ihre Kämpfer zur Vergewaltigung von Frauen in anderen Bundesstaaten aufgefordert hatte, passte verstörend ins Bild.
Emirate räumen Fehler ein
Allerdings räumte die Führung der VAE jetzt zum ersten Mal offen Fehler in ihrer Sudan-Politik ein – allerdings nur für die Zeit vor dem Krieg. In Bahrain erklärte Anwar Gargash, außenpolitischer Chefberater des Präsidenten, die Emirate und andere Staaten hätten sich 2021 geirrt, als sie keine Sanktionen gegen die Initiatoren des Putsches gegen die damalige Übergangsregierung verhängten – also jene Generäle der heute rivalisierenden Kriegsparteien, die damals gemeinsam die zivile Übergangsregierung stürzten und so den Weg in den heutigen Bürgerkrieg ebneten. Es sei, so Gargash, „ein kritischer Fehler gewesen, nicht früh genug eine rote Linie zu ziehen“.
Europa und die USA gehen derweil weiterhin eher zögerlich mit den VAE um. Zwar setzen Washington und Brüssel seit langem Sanktionen gegen einige emiratische Firmen durch, die der Kooperation mit der RSF beschuldigt werden. Doch der politische Druck bleibt überschaubar. Die VAE sind für den Westen sicherheitspolitisch wichtig: Tausende US-Soldaten sind auf der Basis Al Dhafra, von dort werden iranische Drohnenbewegungen überwacht.
Auch wirtschaftlich sind die Emirate zuletzt immer bedeutender geworden – als Finanzstandort, Energielieferant und über ihre weltweite Hafenlogistik. So haben die VAE strategischen Einfluss über Investitionen, Logistikabkommen und Kredite im Umfeld des Hafens Walvis Bay in Namibia, über den bald grüner Wasserstoff nach Deutschland gebracht werden soll.
Russland und Iran gewinnen an Einfluss
Immerhin besuchte die deutsche Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, im Oktober Sudans Militärregierung in der Hafenstadt Port Sudan, wo aktuell alle sudanesischen Ministerien angesiedelt sind. Sie war dort die erste westliche Politikerin seit Kriegsbeginn vor zweieinhalb Jahren. Beobachter drängen auf mehr Gespräche, um ein Gegengewicht zu Russland und Iran aufzubauen, die dort am geopolitisch wichtigen Roten Meer an Einfluss gewinnen.
Danach reiste Güler weiter in die Emirate, wo sie die RSF-Unterstützung wohl zumindest vorsichtig angesprochen hat. „Mit Freunden bespricht man aber auch schwierige Themen, darunter Sudan“, schrieb sie auf Instagram. „Ich habe unterstrichen, dass die VAE all ihren Einfluss auf die Rapid Support Forces in Sudan nutzen sollten, um weitere Gewalt und Kriegsverbrechen zu verhindern.“
Für den Massalit Duda kommt das zu spät. „Wir sterben durch Bomben – oder an Hunger“, hatte er im Juli am Telefon gesagt. Ein bis zwei Monate blieben ihm und seiner Familie noch, so Duda damals weiter.
Am Ende waren es drei.
Christian Putsch ist Afrika-Korrespondent. Er hat im Auftrag von WELT seit dem Jahr 2009 aus über 30 Ländern dieses geopolitisch zunehmend bedeutenden Kontinents berichtet.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.