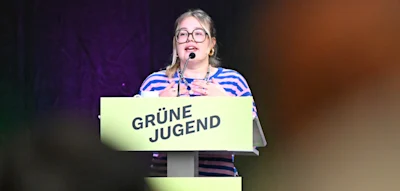In den Tagen nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 klingelte ein Mann in Bonn mehrmals bei einem älteren jüdischen Ehepaar. Als er drohte, beim nächsten Mal mit seinem „großen Aschenbecher“ zu kommen, in den „die Asche von 500 Güterwagen“ hineinpasse, ging das Paar zur nächsten Polizeidienststelle, um Anzeige zu erstatten.
„Der Polizeibeamte vor Ort riet ihnen aber von einer Anzeige ab und begründete dies auch damit, dass er den antisemitischen Charakter und den bedrohlichen Inhalt der Aussage nicht erkennen könne“, heißt es in einer am Dienstag vorgestellten Studie des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias).
Die Polizei sah in diesem Fall keinen Anfangsverdacht, heißt es in der Studie der Soziologen Colin Kaggl und Bianca Loy. Die Voraussetzung für die Einleitung von Ermittlungen fehlte also. Ermittlungen wurden dann nur deshalb aufgenommen, weil Rias den Fall in Rücksprache mit den betroffenen Senioren direkt an den Staatsschutz übermittelt hatte. Dass Betroffene antisemitischer Straftaten den Eindruck haben, ihr Anliegen werde von der Polizei nicht ernst genommen, wird den Rias-Meldestellen immer wieder bekannt.
Bereits seit Jahren zeigen Befragungen, dass Betroffene antisemitischer Vorfälle diese selten anzeigen. Sie begründen dies etwa mit der Befürchtung, eine Anzeige würde keine Konsequenzen nach sich ziehen. Viele Befragte berichten zudem über ein mangelndes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Genannt werden auch die Vielzahl antisemitischer Erlebnisse sowie Kenntnisse über antisemitische Einstellungen innerhalb der Polizei.
Rias hat nun systematisch Polizeistatistiken ausgewertet sowie Experten aus der Polizei, Justiz, Wissenschaft und Zivilgesellschaft interviewt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Leerstellen in der Erfassung und Statistik judenfeindlicher Hasskriminalität. „Festzuhalten ist, dass die polizeiliche Statistik unterkomplex konzipiert ist und viele Fälle unerfasst bleiben, sodass sie der gesellschaftlichen Realität nur eingeschränkt gerecht wird“, heißt es in der Studie.
Das Erfassungssystem zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) war in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden. Bis zum Jahr 2024 galt etwa die Sonderregel, antisemitische Straftaten grundsätzlich dem Phänomenbereich „PMK rechts“ zuzuordnen, sofern keine Hinweise auf einen anderen Phänomenbereich vorlagen. Dies führte zu einem „nach rechts verzerrten Bild“ der Tätermotivation, stellte der vom Bundestag eingesetzte Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus bereits 2017 fest.
Fehlende Kenntnisse, um Antisemitismus zu erkennen
Die Studienautoren Kaggl und Loy rekonstruieren die PMK-Statistik als „Ergebnis von Entscheidungen handelnder Individuen“. Sie analysieren, dass eine antisemitische Straftat erst dann vom Dunkelfeld in das Hellfeld politisch motivierter Straftaten treten kann, wenn der Polizei die Tat erstens bekannt wird, diese zweitens als ausreichend schwerwiegend befunden und drittens als politisch motiviert, extremistisch oder als ein Fall von Hasskriminalität registriert wird.
Ob und wie antisemitische Straftaten als solche registriert werden, sei allerdings „in starkem Maß von der sie aufnehmenden Einzelperson abhängig“. Vielfach würden Informationen fehlerhaft aufgenommen; Hinweise blieben unermittelt. Eine Rolle dabei spiele auch die enorme Arbeitsbelastung bei der Polizei.
Während Interviewpartner aus der Polizei das Erkennen eines antisemitischen Motivs als „eher einfach“ und „relativ unkritisch“ bewerten, kommen die Mitarbeiter des vom Berliner Senat geförderten Projekts „Regishut“, das Berliner Polizisten in der Aus- und Fortbildung zum Thema Judenhass sensibilisiert, zu gänzlich anderen Einschätzungen. Sie konstatieren vielfach fehlende Kenntnisse, um Antisemitismus zu erkennen.
Insbesondere gelte dies für israelbezogenen und verschwörungsideologischen Antisemitismus, weniger für rechtsextremen Antisemitismus. Auch die Rias-Meldestellen berichten immer wieder von Erlebnissen, bei denen die Beamten im Erstkontakt antisemitische Anfeindungen als „Jugend- oder Kinderstreich“ abtaten.
Innerhalb der Polizeistatistiken werden die Straftaten verschiedenen Themenfeldern zugeordnet. Die nun veröffentlichte Analyse zeigt, dass etwa Befürwortungen der Terrorangriffe vom 7. Oktober 2023 dem Themenfeld „Hamas“ zugeordnet wurden, in der Regeln aber nicht zusätzlich dem Themenfeld „antisemitisch“. Auch etwa eine Holocaust-Relativierung auf einer israelfeindlichen Demonstration – ein Schild mit der Aufschrift „Holocaust vergessen?“ – wurde zwar als Volksverhetzung angezeigt und dem Themenfeld „Israel“ zugeordnet, nicht aber zusätzlich dem Themenfeld „antisemitisch“.
Die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik sind hochrelevant und werden jährlich in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Verfassungsschutz-Ämter ziehen sie für ihre Berichte heran, die parlamentarische Opposition nutzt zahlenmäßige Veränderungen in den jeweiligen Phänomenbereichen politisch motivierter Kriminalität („links“, „rechts“, „ausländische Ideologie“, „religiöse Ideologie“) als Gradmesser für Erfolge und Misserfolge der Innenpolitik.
Die Rias-Studie wertet die genannte Einteilung als „zu eng und zu wenig differenziert“, insbesondere im Themenfeld „Hasskriminalität“. Der Bereich, aus dem politisch motivierte Straftaten stammen können, sei durch die Kategorien „auf die vermeintlichen Ränder der Gesellschaft festgelegt“ – auf linke, rechte, religiöse Extremisten.
Tatsächlich gingen antisemitische Straftaten aber „oftmals nicht von organisierten Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstätern aus, die über ein klares und manifestes Weltbild gemäß der Extremismus-Skala verfügen würden“, heißt es in der Studie. Hasskriminalität setze zudem „kein erkennbares beziehungsweise tatleitendes ideologisches Weltbild oder eine bewusste Intention voraus“. Die Verengung auf das Extremismusmodell in der Polizeistatistik bewerten die Forscher daher kritisch.
Das System tendiere zu einer engen Definition politischer Motivation, bei der vorausgesetzt werde, dass den Tätern ihr Motiv bewusst sei. Die für die Studie befragten Wissenschaftler plädieren hingegen für eine weiter gefasste Definition, die etwa „eine bestimmte Sozialisation in Familie oder Subkultur“ einschließen könne, „und zwar, ohne dass dafür eine starke ideologische Bindung an organisierte Parteien oder politische Bewegungen feststellbar sein müsse“.
Das Bekanntwerden antisemitischer Handlungen von Polizisten, aber auch „jede einzelne Erfahrung, dass der erlebte und zur Anzeige gebrachte Antisemitismus von Polizeidienststellen nicht erkannt wird“, wirke sich „negativ auf das Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden und deren Bereitschaft, sich an die Polizei zu wenden, aus“, sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbands Rias. Alle Dienststellen seien „in der Pflicht, Beamtinnen und Beamten aller Dienstgrade zu befähigen, antisemitische Straftaten konsequent zu erkennen und zu verfolgen“.
Politikredakteur Frederik Schindler berichtet für WELT über die AfD, Islamismus, Antisemitismus und Justiz-Themen. Zweiwöchentlich erscheint seine Kolumne „Gegenrede“.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.