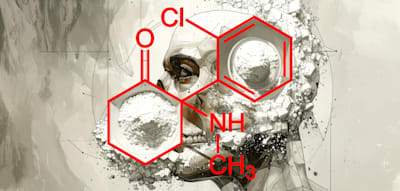Wie Frauen über Geld denken, ist laut Dani Parthum kein Zufall. Im Interview erzählt die Diplom-Ökonomin, wie alte Rollenbilder bis heute nachwirken, weshalb finanzielle Unabhängigkeit essenziell ist und warum Frauen eine Entschädigung für Haushalt und Kinderbetreuung einfordern sollen. In ihrem neuen Buch "Frauen können Finanzen!" erklärt sie die Prinzipien des klugen Geldumgangs, wie Frauen ihre gesetzliche Rente stärken und wie ein pragmatischer Vermögensaufbau gelingen kann.
ntv.de: Sie schreiben selbst: Es war noch nie so einfach, gut mit Geld umzugehen. Das Wissen dafür ist leicht zugänglich. Auch Ratgeber, die sich explizit an Frauen wenden, gibt es zuhauf. Warum braucht es Ihr Buch?
Dani Parthum: Das Gerücht, Frauen könnten nicht mit Geld umgehen, hält sich leider hartnäckig. Und diese Annahme entmündigt und entmutigt Frauen finanziell. Ehefrauen mussten in der BRD bis 1969 ihre Geschäftstätigkeit mit dem Beginn ihrer Ehe abgeben. Der Ehemann musste auch zustimmen, wenn seine Frau erwerbstätig sein wollte. Das Familienrecht hat damals nämlich geregelt, dass Frauen sich um den Haushalt zu kümmern haben. Sie durften lange auch kein eigenes Konto haben, wohlgemerkt in der BRD. In der DDR waren Frauen den Männern rechtlich gleichgestellt.
Das ist lange her. Inzwischen haben Frauen die gleichen Möglichkeiten wie Männer.
Das mag rechtlich so sein. Die entmündigenden Strukturen aber sind über Generationen gewachsen – und das hängt uns an. Deswegen braucht es immer noch solche Sachbücher, wie ich es geschrieben habe, um Frauen zu sagen: "Auch du kannst das mit dem Geld!" Ich will sie ermutigen, sich eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit allem Finanziellen anzugewöhnen – weil es ihnen einfach zusteht. Außerdem ist der Glaubenssatz "Geld ist nicht wichtig" unter Frauen leider noch weitverbreitet. Und dieser Satz ist ein gefährlicher Irrtum.
Inwiefern hindert die Einstellung zu Geld Frauen daran, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen?
Negative Glaubenssätze hindern Frauen daran, für sich einzustehen. Wie wir über Geld denken, hat ganz viel mit uns persönlich zu tun. Wenn der Glaubenssatz lautet: "Geld ist nicht wichtig", dann schwingt mit: "Ich bin nicht wichtig." Die meisten Frauen haben ihre eigenen Bedürfnisse und Talente über Jahrhunderte zurückstellen und ihre Träume für die Familie aufgeben müssen. Wenn Frauen anfangen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, dann beschäftigen sie sich mit sich selbst - und mit dem, was sie wollen.
Gehen jüngere Frauen das Thema selbstbewusster an?
Ich bin noch in dem geistigen Klima aufgewachsen, ich als Frau sei weniger wert als ein Mann. Jüngere Frauen sehen ihre Mütter heutzutage selbstverständlich erwerbstätig sein und wissen, dass eigenes Geld wichtig ist. Es ist also auch eine Generationenfrage, ja. Frauen ab etwa 40 Jahren sind oftmals noch stark geprägt von dem veralteten Denken und der stereotypen Rollenverteilung. Gleichzeitig beobachte ich aber auch: Während viele junge Frauen finanziell unabhängig sein wollen, gibt es einige unter ihnen, die dem Lebensmodell der 50er Jahre wieder einiges abgewinnen können.
Das ist der sogenannte Tradwife-Trend ...
Genau. Das macht mich sehr wütend, weil die jungen Frauen offensichtlich nicht sehen, wie riskant dieses Lebensmodell für sie ist. Sie machen sich komplett abhängig vom Geld ihres Mannes, von seinem Denken und Verhalten. Sie geben damit die Kontrolle über ihr Leben aus der Hand. Im Jahr 2025! Und dazu noch freiwillig! Mir ist das völlig unverständlich, sich selbst so zu entmündigen.
In Ihrem Buch erwähnen Sie an einigen Stellen, dass Sie in der DDR aufgewachsen sind. Hat diese Herkunft einen Einfluss auf Ihre Einstellung zu Geld?
Ja, denn auch ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, Geld sei nicht so wichtig. Aber aus anderen Motiven. Die politische Ideologie der DDR war der Sozialismus, die Vorstufe zum Kommunismus. Im Kommunismus gibt es aber kein Geld. Jeder arbeitet nach seinen Talenten und Fähigkeiten und bekommt von der Gesellschaft, was er oder sie braucht. Das hat mich geprägt. Und außerdem: In der DDR konnte man sich für Geld ja nicht wirklich viel leisten. Ich hätte weder nach London fliegen noch mir einen teuren Armani-Fummel kaufen können. Mit Geld war kein Prestige verbunden. Noch heute kann ich mit obszönem Luxus und finanziellen Prestigeobjekten wenig anfangen. Unser Umfeld prägt, wie wir über Geld denken. Das kann positiv sein, ist es meist aber nicht – gerade für uns Frauen nicht. Das zu hinterfragen ist unabdingbar, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Denn ohne Geld ist ein selbstbestimmtes Leben unmöglich.
Was müssen Frauen unternehmen, um selbstbewusst Finanzentscheidungen treffen zu können?
Zuerst ist wichtig, zu reflektieren, wie sie über Geld denken. Die emotionale Geld-Haltung ist einer der wesentlichen Schlüssel, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Denn Freiheit und Selbstbestimmung sind eng mit Geld verknüpft. Im zweiten Schritt bitte klären: Wofür gebe ich mein Geld aus? Wie viel verdiene ich? Investiere ich meine finanziellen Ressourcen sinnvoll? Wenn die Prioritäten abgeklärt und überflüssige Kostenfresser ausgemacht und gestrichen sind, geht es an den Vermögensaufbau. Es führt kein Weg daran vorbei, selbst investieren zu lernen.
Vermögensaufbau gelingt nur durch Investieren: In Deutschland legen laut dem Aktieninstitut insgesamt 4,7 Millionen Frauen ihr Geld in Aktien an, bei den Männern sind es 7,6 Millionen. Wovor schrecken Frauen bislang noch zurück?
Bei meinen Klientinnen stelle ich immer wieder fest: Bevor Frauen anfangen zu investieren und ihr Geld aus der Hand geben, wollen sie wirklich viel darüber wissen. Hinzu kommt, dass Frauen im Schnitt leider immer noch weniger Geld zur Verfügung haben, deswegen halten sie es noch ein wenig fester. Frauen sind zudem sehr risikobewusst. Es ist diese Mischung aus: Wir wollen Bescheid wissen, wir haben nicht ganz so viel Geld und wir sind risikobewusst. All das ist aber eine Stärke! Studien zeigen, dass Frauen sehr erfolgreiche Investorinnen sind – und ich kann das bestätigen.
Warum ist das so?
Frauen verbinden mit der Geldanlage häufig keinen Hobbygedanken, wie es Männer oft tun. Sie möchten sich damit nicht ständig beschäftigen. Das kommt ihnen bei der Geldanlage entgegen. Informiert investieren, liegen lassen, immer mal ein wenig nachjustieren, das bringt Erfolg. Frauen verbinden mit dem Investieren auch kein Image oder Prestige. Sie wollen ein Ziel erreichen, und das schützt ihr Vermögen. Die vermeintlichen Hürden, die Frauen oft noch vom Investieren abhalten, sind also genaugenommen ihre Stärken.
Finanzcoachings, die sich speziell an Frauen richten und sie beim Investieren begleiten, kosten schnell ein paar tausend Euro. Bieten sie einen so großen Mehrwert, dass sie einen vierstelligen Betrag rechtfertigen?
Die Hürde, mit dem Investieren anzufangen, ist für Frauen – aber auch für viele Männer – oft hoch. Bedenken Sie: Die Finanzindustrie ist von Männern auf Basis einer technisch-kalten Sprache entwickelt worden, und Frauen waren überwiegend ausgeschlossen. Manche brauchen deshalb jemanden, der sie an diese Welt heranführt. Deswegen haben diese Kurse durchaus ihre Daseinsberechtigung – genauso wie Kurse für Ernährung, Elternschaft oder Persönlichkeitsentwicklung. Ich selbst biete Vermögenskurse explizit für Frauen als geschützten Raum an. Meine Erfahrung zeigt: In Kursen mit Coaches vom Fach, also einschlägiger, nachgewiesener Ausbildung und eigener Erfahrung, kommen Teilnehmerinnen in der Regel schneller ans Ziel und machen weniger teure Fehler. Stehen die Kurspreise im Verhältnis dazu, was frau lernt, ist das gut investiertes Geld. Dafür muss das erlernte Wissen aber auch wirklich umgesetzt werden. Wenn solche Programme mehr als 2000 Euro kosten, rate ich zur Vorsicht. Ein guter Indikator ist auch: Wie transparent ist der Preis, und was bekomme ich genau für mein Geld?
Besonders für Mütter führt kein Weg daran vorbei, den Vermögensaufbau gezielt anzugehen. Im Vergleich zu einer kinderlosen Frau büßen 35-jährige Mütter mit einem Kind laut einer Bertelsmann Studie im Schnitt 520.000 Euro an Einkommen ein, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Dieses "Bußgeld" ist nirgends in Europa so hoch wie in Deutschland. Vor allem lange Erwerbsunterbrechung und Teilzeitarbeit kosten Mütter ein Vermögen. Was läuft falsch in Deutschland?
In Deutschland hat sich durch die frühere Gesetzeslage der Automatismus festgesetzt, dass Frauen, wenn sie Mütter werden, die Care- und Sorgearbeit übernehmen und zu Hause bleiben. In Skandinavien hat sich längst eine gleichberechtigte Elternschaft etabliert. Dort fühlen sich Männer und Frauen gleichermaßen verantwortlich. Hierzulande nicht. Statistiken zeigen, dass sich bei Männern, sobald sie Väter werden, kaum etwas in der Erwerbsstruktur ändert. Im Gegenteil arbeiten sie sogar eher mehr. Frauen hingegen treten wie auf Autopilot zurück. Viele werdende Eltern sprechen vor der Geburt gar nicht darüber, wie sie die Arbeiten rund um das Kind und ihre Erwerbstätigkeit gleichberechtigt aufteilen. Es wird einfach angenommen, das ergibt sich schon. Und das ist eine große Fehleinschätzung. Väter verzichten mehrheitlich nicht auf ihre finanzielle Autonomie. Die Mütter schon. Es ergibt sich also eine Schieflage auf Kosten der Mütter. Kommunikation ist hier eine Lösung. Frauen sollten selbstbewusst ihre Wünsche aussprechen und Gleichberechtigung einfordern, und Väter ihre Vaterschaft aktiv leben, mit allen Konsequenzen, die sie von ihren Frauen wie selbstverständlich verlangen.
Sie raten Frauen, dass sie von ihren Männern eine finanzielle Entschädigung für Haushalt und Kinderbetreuung einfordern. Aus Ihrer Erfahrung als Coach: Wie hoch ist die Bereitschaft unter Männern dazu?
Frauen, die zu mir kommen, berichten viel Positives. Männer reagieren häufig auf Zahlen. Vielen Frauen hat geholfen, ihre Stunden für Haushalt und Kindererziehung mit einem Preislabel zu versehen, etwa dem Mindestlohn oder ihrem eigenen Lohn aus der Erwerbstätigkeit. Dann wird schnell klar, auf welche Summen Frauen verzichten, während die Männer weiterarbeiten dürfen. Ich sage bewusst: dürfen. Denn sie können nur erwerbstätig sein, weil die Frauen einen Großteil ihrer Elternarbeit mitübernehmen – unbezahlt! Erwerbsarbeit umfasst auch so viel mehr als nur Geld verdienen und Karriere machen. Mit der Entscheidung, ihren Job aufzugeben oder in Teilzeit zu gehen, verzichten Frauen auf Absicherung, haben weniger Rente, weniger Krankentagegeld, weniger Absicherung bei Jobverlust. Das mit dem Partner einmal alles aufzuschlüsseln, erhöht die Bereitschaft, über Ausgleiche zu verhandeln. Am besten, bevor ein Kind kommt.
Haben Sie das in Ihrer Partnerschaft auch so geregelt?
Mein Mann und ich leben Familie als Patchwork mit nun drei erwachsenen Kindern. Wir teilen Erwerbseinkommen, Care- und Hausarbeit und Vermögen. Uns beiden ist unsere finanzielle Eigenständigkeit sehr wichtig. Wir unterstützen uns gegenseitig im Beruf und haben das Kümmern um die Kinder fair aufgeteilt. Uns kam zugute, dass wir beide im Schichtdienst arbeiteten, als die Kinder klein waren. Wir haben auch früh festgelegt, was finanziell passiert, wenn wir uns trennen. Natürlich streiten wir uns auch mal über Finanzielles, aber immer auf Augenhöhe und mit der Haltung, dem anderen alles zu gönnen. Über Geld sprechen wir am Küchentisch ähnlich selbstverständlich wie über das Wetter.
Was, wenn Männer sich weigern? Wertschätzung in einer Partnerschaft kann sich auch anders äußern als durch Geld?
Sicher, aber verbale Wertschätzung schützt Frauen nicht vor Altersarmut und Abhängigkeit. Wenn ein Mann nicht bereit ist, die wertvolle Arbeit seiner Frau auch finanziell anzuerkennen und sie auszugleichen, dann würde ich hinter dieser Partnerschaft ein ganz großes Fragezeichen setzen. Geld ist ein brutaler Katalysator für den Stand einer Beziehung. Gönnt man sich alles oder wird jeder Cent kleinteilig aufgerechnet. Hat jeder ein Konto oder darf sie nur seine Girocard benutzen? Gängelt oder dominiert man den anderen etwa sogar mit Geld? Wird für die Care-Arbeitende eine eigenständige Altersvorsorge aufgebaut oder das abgelehnt, weil es "zu teuer" oder "nicht drin" ist? Deswegen rate ich allen Frauen: Schaut auf eure Beziehungen. Wenn ihr nicht über Geld sprechen und verhandeln könnt und ihr kein Geld in eurer Verfügungsmacht habt, dann führt ihr keine Beziehung auf Augenhöhe.
Mit Dani Parthum sprach Juliane Kipper
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.