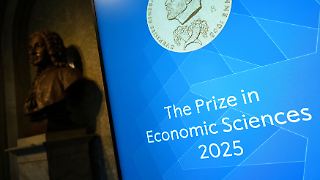Fünf Barbershops kontrollierten die Finanzbeamten – und sie stellten in einen äußerst laxen Umgang mit den Einnahmen fest. In einem Laden gab es nicht einmal eine Kasse. Geschäftsführer wurden nirgendwo angetroffen, drei Mitarbeiter hätten laut Aufenthaltsstatus gar nicht in einem auf Männerhaar- und Bartschnitte spezialisierten Friseurladen arbeiten dürfen. Das ist die Bilanz einer Razzia in Hamburg-Harburg vergangene Woche. Beteiligt waren neben Vertretern der Finanzbehörden auch Mitarbeiter des Bezirksamts, des Bauamts, der Friseurinnung und der Hamburger Polizei.
Damit kann sich die Politik bestätigt fühlen. Sie arbeitet gerade an einem neuen Gesetz, mit dem sie die staatlichen Verluste durch Steuerhinterziehung, Sozialabgabenbetrug und Geldwäsche reduzieren will. „Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung“, ist der Titel. Zu dem Entwurf äußerten sich nun geladene Experten gegenüber dem Finanzausschuss des Bundestages. Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich ein Umsatz in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrags in der Schattenwirtschaft gemacht wird, wodurch dem Staat ein zweistelliger Milliardenbetrag an Steuern und Sozialabgaben entgeht.
Barbershops gehören genauso wie Nagelstudios zu den „zuletzt besonders auffälligen Bereichen“ für Schwarzarbeit, schrieb Constanze Voß, Leiterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, einer Einheit des Zolls, in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf. Seit Jahren sind beide Geschäftsmodelle aus den Einkaufsstraßen vieler Städte nicht mehr wegzudenken. Ihre Kontrolle ist bislang gering, gehört das Friseur- und Kosmetikgewerbe doch noch nicht zu den „gesetzlichen Schwarzarbeitsschwerpunktbranchen“. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. Voß begrüßte den Schritt. Sie geht davon aus, dass durch die Erweiterung um das Friseur- und Kosmetikgewerbe die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit erheblich erleichtert werden.
In der Praxis bedeutet dies unter anderem, dass künftig alle Beschäftigte von Barbershops und Nagelstudios verpflichtet sind, einen „Personalausweis, Passersatz oder Ausweisersatz“ bei der Arbeit mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen, wie es in Paragraf 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes heißt. Das gilt heute schon für elf Wirtschaftsbereiche. Dazu gehören das Baugewerbe, Reinigungsunternehmen und die Gastronomie. Aber auch für Schausteller, die Fleischwirtschaft, das Prostitutionsgewerbe und für Wach- und Sicherheitspersonal gilt dies bereits.
Zollgewerkschaft will auch Landwirte prüfen
In der Branche begrüßt man die erleichterten Kontrollen, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) deutlich machte. „Eine konsequente Prüfung des Friseur- und Kosmetikgewerbes ist aufgrund erheblicher Strukturveränderungen innerhalb der Branche dringend erforderlich“, teilte der ZDH in seiner Stellungnahme mit. Ihm geht es um den Schutz der klassischen Betriebe. Ein Barbershop, der sich ausschließlich auf Rasur und Bartpflege beschränke, komme selten vor. Vielmehr würden dort genauso Dienstleistungen aus dem Kernbereich des Friseurhandwerks angeboten, etwa reguläre Herren- und auch Damenhaarschnitte, dies aber zu vergleichsweise „sehr niedrigen Preisen“.
Beim Handwerksverband stört man sich vor allem daran, dass die Anforderungen eines klassischen Betriebs wie Ausbildung, Eintragung in die Handwerksrolle und Zulassung dort nicht erfüllt würden. „Dies lässt den Verdacht aufkommen, dass dort keine ordnungsgemäße Abführung von Steuern und Sozialabgaben erfolgt und die dort beschäftigten Personen nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet werden“, schließt der ZDH daraus.
Auch bei der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ begrüßt man die Erweiterung der Liste um das Friseur- und Kosmetikgewerbe – und auch die Klarstellung, dass damit auch Barbershops und Nagelstudios gemeint sind. Geht es nach der Gewerkschaft gehören auf die Liste der Problembranchen aber noch andere. „Nicht umgesetzt wurde hingegen unsere Anregung, die Landwirtschaft sowie Pflegebranche aufzunehmen“, heißt es in der BDZ-Stellungnahme.
In der Landwirtschaft würden viele ausländische Saisonarbeitskräfte eingesetzt, die oft als sozialversicherungsfreie Kurzzeitbeschäftigte gemeldet würden. Leider übten diese Arbeitnehmer oft mehrere solcher Beschäftigungen hintereinander aus, in der Regel bei verschiedenen Arbeitgebern, die davon nicht wüssten. „Als sozialversicherungsfrei würden die Beschäftigungen dann nicht mehr gelten“, so die Kritik. Ähnliches werde in der Pflege praktiziert.
Die Zollgewerkschaft will jedoch verhindern, dass die Liste des Paragrafen 2a immer länger wird. Grundlage sollten die tatsächlichen Prüfungsergebnisse und Risikobewertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sein. „Branchen, in denen seit Jahren keine signifikanten Beanstandungen festgestellt werden, sollten im Gegenzug entlastet werden können, während neue Risikofelder zügig in den Katalog aufgenommen werden“, schreibt der BDZ. Eine solche dynamische Anpassung trägt aus Sicht der Gewerkschaft zu zielgenauen und ressourcenschonenden Prüfungen bei und könne ein Anreizmodell für die Wirtschaft sein. Sprich: Es könne gezielter und letztlich erfolgreicher geprüft werden.
Digitalisierung entlastet die Wirtschaft
Der risikobasierte Ansatz taucht an mehreren Stellen im Gesetzentwurf auf. Die Vertreterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verwies dabei auf die angestrebten Digitalisierungsfortschritte. Sie hob positiv hervor, dass Geschäftsunterlagen künftig auch in elektronischer Form angefordert werden können. Dies vereinfache die Prozesse und entlaste die Wirtschaft genauso wie die Verwaltung, so Voß.
Bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßt man den gezielteren Risikoansatz. Allerdings ist man dort skeptisch, dass dies tatsächlich ohne größeren Aufwand gelingt. Es sei nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet bei den Problembranchen die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht ausgeschöpft würden.
„So sind zum Beispiel Vor-Ort-Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf Baustellen und in anderen Einsatzbereichen durchaus wirkungsvoller und nachhaltiger durchzuführen, wenn der Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen in elektronischer Form ermöglicht wird“, schreibt die BDA. Schriftliche Arbeitsverträge oder der schriftliche Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen würden im Normalfall nicht am Körper geführt. „Effiziente Bekämpfung von Schwarzarbeit setzt eine nachhaltige Digitalisierung voraus.“
Leichter werden soll laut Gesetzentwurf in jedem Fall die Kommunikation der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit anderen Behörden, zum Beispiel durch einen schnellen und digitalen Austausch von Informationen mit Polizei oder Steuerfahndung. Der Entwurf schafft mehr Möglichkeiten mit Künstlicher Intelligenz, Datenbanken zu durchsuchen, um verdächtige Unternehmen aufzuspüren und gezielt zu durchleuchten.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und Business Insider erstellt.
Karsten Seibel ist Wirtschaftsredakteur in Berlin. Er berichtet unter anderem über Haushalts- und Steuerpolitik.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.