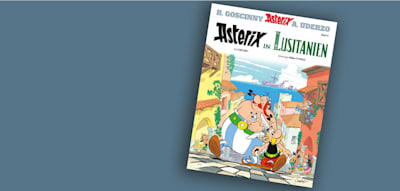Lea Ypis Großmutter Nini kennen die Leser ihres Bestsellers „Frei“ bereits. Die Oma, die mit korrektem Vornamen Leman hieß, taucht in den Jugenderinnerungen der Enkelin immer wieder als weise, skeptische Balkandame auf, die sich in den irren Wendungen der albanischen Geschichte vom Steinzeitstalinismus über anarchischen Bürgerkrieg hin zum Räuberkapitalismus von gar nichts mehr beeindrucken lässt, weil sie in ihrem langen Leben noch Schlimmeres mitgemacht hat. Ihre Enkelin, die als politische Philosophin an der „London School of Economics“ lehrt, wurde mit „Frei“ ganz nebenbei zur bekanntesten albanischen Schriftstellerin, obgleich die polyglotte Autorin längst auf Englisch schreibt und sich hinterher selbst in ihre Muttersprache übersetzt.
„Aufrecht“, dem knapp 400 Seiten starken Prequel, wird es sicher nicht anders ergehen als „Frei“. Hier konzentriert sich die Enkelin vollends auf die Biografie der 2006 gestorbenen Großmutter, die – so Lea Ypi – „niemals aufgehört hat, mit mir zu sprechen“. „Überleben im Zeitalter der Extreme“ ist als Untertitel fast noch untertrieben. Denn die sture Leman Ypi hat ihr grauenvolles Jahrhundert der Nationalismen, Rassismen und weiteren tödlichen politischen Ideologien nur mit ganz knapper Not überlebt.
Die Wurzeln der Ypi-Familiensaga liegen wie bei eigentlich allen Balkangeschichten im Osmanischen Reich, das über Jahrhunderte durch Knabenraub oder andere Finessen des Feudalismus hohe Würdenträger des Imperiums gerne aus Albanien rekrutierte. So tauchen die Leser an der Hand der Enkelin ein in die untergegangene Welt, in welcher der Sultan in Istanbul mit Erlassen über Lebensläufe entschied und wo die kleine, aber sehr feine Oberschicht mit Nationalitäten und Sprachen nur so jonglierte. Einige Frauen waren albanisch, ohne je im Kern-Albanien gewesen zu sein, Opas und Onkel hatten französische Gymnasien in der albanischen Stadt Manastir besucht, die heute Bitola heißt und in Nord-Mazedonien liegt. Untereinander sprach man Französisch, im Amt Türkisch und reiste zu den Flitterwochen nach Paris, zum Skilaufen nach Cortina und sommers an den Gardasee.
Zufällig, aber keineswegs willkürlich landete Leman Ypi, die Heldin dieser literarischen Biografie, in Thessaloniki, der osmanischen Vielvölkerstadt, in welcher sephardische Juden die relative Mehrheit, die Griechen die ländlichen Ureinwohner und die Türken die Verwalter stellten. Leman selbst hat dort immer wieder Probleme mit ihrer exakten Identität. So kommen über Heiraten und Vetternschaften der lax islamischen Familie noch türkische Bedienstete, die zum Christentum übertreten oder Angehörige der jüdischen Islamsekte der Dönme hinzu. Wir treffen in den allerletzten Glanzjahren dieses alten „Saloniki“, das Mark Mazower in einem Meisterwerk der jüngeren Historiografie gültig beschrieben hat, auch auf den Hamburger Tabakhändler Gustav Heym, der aus Geschäftsgründen Lemans Tante Selma heiraten soll. Doch statt sich mit einem deutschen Protofaschisten zusammenzutun, bringt sie sich am Hochzeitstag lieber um. Inschallah.
Wie in einem Roman von Graham Greene
Auch weniger tödliche Extravaganzen gehören zur Familiengeschichte, so etwa die 100 vom Sultan geschenkten Kanarienvögel, die allzeit im Familienpalais zu Thessaloniki gefüttert werden, bis auch die um ihre Freiheit trällernden Tierchen lange nach dem verheerenden Großbrand von 1917 in den ideologischen Bränden den griechischen Nationalismus und des nationalsozialistischen Rassenwahns mitsamt ihren Besitzern verlorengehen.
Da wohnt die Heldin dieses Buches bereits in Tirana und gerät dort in die gefährlichen Strudel der albanischen Nationwerdung, die in Lea Ypis Schilderung während des Zweiten Weltkriegs mit roten Terroristen, italienischen Kollaborateuren, fidelen Wehrmachtlern und britischen Agenten wirkt wie ein Roman von Graham Greene. Arbeitstitel: Unsere Frau in Tirana.
Ypi schildert Alltag und Ansichten ihrer Oma in Vorkriegs- und Kriegszeiten, als wäre sie dabeigewesen. In ihren Dialogen spricht Leman zwar höchstens vermittelt, alle anderen reden naturgemäß Erfundenes, aber mit dem trockenen Humor und der politischen Hellsicht der Autorin. In Wahrheit waren die Gespräche sicher weniger geistreich. Etwa wenn Leas Urgroßvater Xhafer Ypi angesichts der inexistenten Armee und der maroden Finanzen Regierungschef Albaniens von Gnaden Mussolinis wird und sich über das Konzept vom Geschichtemachen belustigt: „Für uns wird Geschichte gemacht.“ Was die Welthistorie nicht daran hinderte, den Würdenträger im griechischen Bombenhagel des Krieges 1940 spornstreichs umzubringen.
Enver Hoxha im Kaffeehaus
Man wird durch die literarische Fiktion der Autorin quasi live hereingezogen in solche Dramen. Woher wohl weiß sie so genau, dass bei der Hochzeit ihrer Großeltern die Decke von Regenwasser leckte und sich ein Fleck in den Formen Groß-Albaniens abzeichnete? War sie etwa dabei, als bei einem frühen Rendezvous im Café Kursaal in Tirana sich ein aufsässiger Studienfreund ihres Opas rabiat ins Gespräch mischte? Der Mann hieß Enver Hoxha und sollte nach 1945 als kommunistischer Tyrann und Blutsauger das Leben der bourgeois-liberalen Ypis höchstpersönlich zerstören.
Großmutter Leman hatte nach dem Ende des Krieges, in dem weder sie noch ihr Mann mit den italienischen Faschisten oder den Nazis kollaboriert hatten, viel Gelegenheit, darüber zu sinnieren, ob ihre Flucht aus einem imaginären Osmanenreich ins sprachliche Vaterland Albanien 1932 wohl eine gute Wahl gewesen war. Das Zeitalter des Nationalismus verschob Millionen Menschen auf dem Balkan in neue Grenzen, rottete Minderheiten bis ins 21. Jahrhundert aus und machte aus toleranten Weltbürgern engherzige Bestien wie Hoxha.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist es ihr Beinahe-Onkel, der agile deutsche Tabakhändler Heym, der Leman samt Mann und Sohn die Flucht nach Italien ermöglicht. Doch statt von einem – wie sie es nennt – „Hakenkreuzgoethe“ retten zu lassen, bleiben die Ypis im Land und fallen als denunzierte Liberale der „Sigurimi“, der Staatssicherheit, in die Fänge.
Wie Leman die 15 Jahre Zwangsarbeit ihres körperlich ruinierten Mannes übersteht, wie sie währenddessen als Landarbeiterin Gruben aushebt, trotz Hunger, Isolation, Vergewaltigungen ihren Sohn am Leben erhält – Lea Ypi deutet all dies am Schluss nurmehr an; vielleicht geht ihr die Puste aus. Dass die Autorin am Ende ihrer Recherchen im nationalen Stasi-Archiv von Tirana eine zweite Leman Ypi in den Akten entdeckt, die ein ganz ähnliches Leben führte und bereits 1972 starb – wir erfahren nicht gänzlich, ob auch dies eine surreale Fiktion der „Sigurimi“ war, um ihre langjährige Bespitzelung zu beenden oder ob das „Zeitalter der Extreme“ auch diese Pointe bereithielt.
Lea Ypi vergleicht ihre Methode, die wahre Familiengeschichte literarisch zu erfinden mit einer Fahrt im Karussell: „Man weiß, am Ende wird man dort stehen, wo man angefangen hat, aber es geht ja auch nicht um das Ziel, sondern um die Fahrt an sich.“ Bitte einsteigen!
Lea Ypi: Aufrecht. Überleben im Zeitalter der Extreme. Aus dem Englischen von Eva Bonné. Suhrkamp, 416 Seiten, 28 Euro.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.