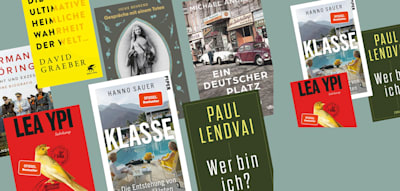Er ist 28 Jahre alt und sein halbes Leben in der Jungen Union: Johannes Volkmann hat das Direktmandat im Lahn-Dill-Kreis gewonnen und redet lieber über Streit als über Harmonie. Ein Gespräch über Konservatismus, Konfliktbereitschaft und die Frage, wie man Populisten Grenzen setzt, ohne selbst populistisch zu werden.
WELT: Herr Volkmann, was ist Ihre konservativste Überzeugung?
Johannes Volkmann: Ich halte eine Migrationspolitik nach dem Prinzip Hoffnung für einen Fehler.
WELT: Führen Sie das bitte aus.
Volkmann: Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass eine ungesteuerte Migration, Migration in die Sozialsysteme und von Milieus, die illoyal zu europäischen Werten stehen, enorme gesellschaftliche Sprengkraft hat. Unsere Aufgabe sollte es sein, den gesellschaftlichen Frieden in dieser Frage wiederherzustellen. Ich bin 28, aber ich erinnere mich noch an Weihnachtsmärkte, die auf Polizeischutz, und Freibäder, die auf Waffen-Kontrollen am Einlass verzichten konnten.
WELT: Was bedeutet das: konservativ sein?
Volkmann: Für mich: Wertschätzung des Eigenen ohne Abwertung des Fremden. Gesellschaftspolitische Fortschrittsideen nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern kritisch auf ihren Mehrwert zu prüfen. Sich auf Kernaufgaben von Staatlichkeit fokussieren: Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Wichtig ist übrigens auch: Die Christdemokratie besteht nicht nur aus Konservativen, sondern ganz wesentlich auch aus christlich-sozialen und liberalen Ideen.
WELT: Gibt es Werte, mit denen Sie aufgewachsen sind und an die Sie heute noch glauben?
Johannes Volkmann: Da gibt es einige. Ein Beispiel: Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Das betrifft Leistungsgerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder die Besteuerung im Mittelstand ebenso wie unsere Migrationspolitik.
WELT: Welche anderen Werte leiten Sie?
Volkmann: Der Vorrang des Rechts vor dem Recht des Stärkeren, nach innen wie nach außen. Das christliche Menschenbild, das den Einzelnen als Individuum in den Mittelpunkt stellt, nicht seine Zugehörigkeit zu einer Klasse oder woken Identitätskategorie. Inklusiver Patriotismus, der ein unverkrampftes und positives Verhältnis zum eigenen Land vermittelt.
WELT: Haben Sie den Eindruck, dass „konservativ“ unter jungen Menschen ein Schimpfwort ist?
Volkmann: Nein. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass weltanschauliche Etiketten an Bedeutung und Eindeutigkeit verlieren. „Rechts“ und „links“ sind als Schlagworte abgenutzt und dienen ja häufiger als Projektion denn als Selbstbeschreibung. Mir fehlen aber ehrlicherweise auch bessere begriffliche Alternativen.
WELT: Welchen Einfluss hat die Religion heute in der Christdemokratie?
Volkmann: Das christliche Menschenbild gibt Platz für alle Glaubensrichtungen in einer Volkspartei wie der Union. Das Christentum ist für mich – auch im Sinne der neutestamentlichen Metapher – Salz und Licht unserer europäischen Kultur. Gleichzeitig ist die Union unabhängig von meinem evangelischen Glauben für mich politische Heimat. Einen Exklusivitätsanspruch auf das C kann es nicht geben – und das ist auch gut so, schließlich ist die Heilige Schrift kein Parteiprogramm.
WELT: Die CDU ist in einer ständigen Auseinandersetzung mit der AfD. Sie muss sich gegen Anfeindungen von rechts wehren und gegen Vorwürfe von links. Wo verläuft die Grenze zwischen Konservatismus und Populismus?
Volkmann: Konservative bewahren und entwickeln Institutionen weiter, Populisten reißen sie ein. Da liegt ein Wesensunterschied.
WELT: Trotzdem wird häufig beides in einen Topf geworfen.
Volkmann: Der Populismusvorwurf wird häufig genutzt, um konservative Positionen zu delegitimieren, gerade von der politischen und der medialen Linken. Wenn Kritik an ungesteuerter Migration sofort als populistisch gilt, spart man sich die inhaltliche Debatte – die man in der Sache links schon längst verloren hat. Das ist eine kurzsichtige Strategie.
WELT: Gibt es für Politiker einen Anreiz, schrill zu formulieren? Oft zitieren Medien das Laute. Das, was Schlagzeilen macht.
Volkmann: So funktioniert unsere digitale Aufmerksamkeitsökonomie. Ich gehe auch davon aus, dass die Überschrift dieses Interviews nach Klickzahlen optimiert sein wird.
WELT: Wie laut müssen Konservative sein? Wenn sie zu leise sind, könnten sie Gefahr laufen, nicht gehört zu werden.
Volkmann: Vielleicht laut genug, um gehört zu werden und leise genug, um anständig zu bleiben? Natürlich dürfen wir im Ton unserer Debatten nicht der Zauberlehrling sein, der Kräfte entfesselt, die er nicht mehr einfängt. Unversöhnlichkeit verhindert Handlungsfähigkeit. In der Kommunalpolitik habe ich gelernt, dass man dann etwas bewegt, wenn man kompromissbereit bleibt. Das sollte man aber nicht mit Selbstaufgabe oder fehlender Konfliktfähigkeit verwechseln.
WELT: In der Union hört man auch Stimmen, die kulturkämpferisch auftreten. Ist das ein Schlüssel zum Erfolg?
Volkmann: Die Lösung liegt im praktischen Regierungshandeln. Wir fordern eine Migrationswende und setzen sie um. Wir haben eine Wirtschaftswende versprochen und sind dabei, sie umzusetzen. Wir haben die Wiederherstellung von Deutschlands Verteidigungsfähigkeit zugesagt und investieren massiv darein.
WELT: Sie halten also Debatten über Indianerkostüme an Karneval für nebensächlich?
Volkmann: Nein. Es ist ja die politische Linke, die immer wieder solche Kulturkämpfe entfesselt, in dem sie vom Fortbewegungsmittel über die Gendersternchen bis zum Schnitzel in zutiefst übergriffiger Art in unsere Gesellschaft eingreift. Sollen wir eine Verschiebung gesellschaftlicher Normen durch eine besonders aggressiv auftretende Minderheit hinnehmen, weil man sich zum Widerspruch zu fein ist? Aber im Ergebnis misst sich der Erfolg von Politik vorrangig nicht Kulturkämpfen, sondern an anderen Fragen.
WELT: An welchen denn?
Volkmann: Haben die Menschen am Monatsende genug im Geldbeutel, um aus eigener Arbeit Wohlstand aufzubauen? Fühlen sie sich im öffentlichen Raum sicher und zugehörig? Sind sie stolz auf ihr Land sein und sehen darin eine Zukunft für sich und ihre Kinder?
WELT: Gleichzeitig sind Kulturkämpfe oft lauter als Diskussionen über Sachpolitik. Politisches Handeln wirkt in einer Demokratie zeitversetzt. Es ist nicht immer leicht, mit konkreten Resultaten durchzudringen.
Volkmann: Diese Analyse würde ich nicht unbedingt teilen.
WELT: Weshalb?
Volkmann: Nehmen wir das Beispiel Migration: Wenn Kommunen weniger überfordert werden, weil ihre kommunalen Haushalte nicht länger durch Migrationskosten kippen, wenn Turnhallen und Schulen nicht mehr als Notunterkünfte beschlagnahmt werden müssen, dann ist schon viel gewonnen. Hier sind wir mit Alexander Dobrindt auf dem richtigen Weg.
WELT: Gibt es neben Migration noch konservative Themen, die sich die CDU von den Populisten zurückholen muss?
Volkmann: Die Frage von Frieden. Hinter mir hängt ein Plakat aus dem ersten Bundestagswahlkampf 1949 „Für den Frieden – CDU“. Heute versuchen AfD, Wagenknecht und andere Agenten der Angst den Friedensbegriff zu vereinnahmen. Frieden soll zu Appeasement umgedeutet werden. Unsere Überzeugung ist: Frieden sichert man durch Stärke. Durch eine verteidigungsfähige Bundeswehr, eingebettet in das europäische und transatlantische Bündnis. Der Vorwurf der Kriegstreiberei ist so billig wie einfältig. Jemand, der seine Verteidigungsfähigkeit absichern will, ist nicht „kriegsgeil“ – genauso wenig wie jemand, der eine Krankenversicherung abschließt, „krankheitsgeil“ ist.
WELT: Wie konservativ ist die Union heute im Vergleich zu 2015, als Angela Merkel Parteivorsitzende war?
Volkmann: Wie bereits gesagt, geht es um wesentliche Aufgaben von Staatlichkeit: Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. 2025 sind diese Themen viel weniger selbstverständlich, als sie 2015 waren.
WELT: Wie meinen Sie das?
Volkmann: Wir erleben eine tiefe Strukturkrise unserer Wirtschaft, vermutlich mittlerweile die Längste seit Bestehen der Bundesrepublik. Unsere Sicherheit ist unmittelbar durch russische Aggression bedroht. Unsere Freiheit wird durch eine gravierende Integrationskrise und Islamisten gefährdet. Beschämenderweise ist jüdisches Leben in deutschen Innenstädten häufig nur noch unter Polizeischutz möglich. Viele Koordinaten, die vor wenigen Jahren selbstverständlich waren, verschieben sich. Deswegen sehen wir in der Wählerschaft eine Rückbesinnung auf das, was wirklich zählt. Ich bin der Überzeugung, dass keine Partei außer der Union diese Probleme bewältigen können wird – auch und gerade weil wir für die Entstehung von manchem Genannten eine Mitverantwortung tragen.
WELT: Bei der Wahl der Verfassungsrichter fiel auf, dass es in der Union sehr unterschiedliche Reaktionen gab. Manche Stimmen klangen identitätspolitisch motiviert, bei anderen schwang ein christlich geprägtes Unbehagen mit. Haben die Spitzen von Partei und Fraktion unterschätzt, wie konservativ manche Abgeordnete der Union noch sind?
Volkmann: Es ist gut, dass die SPD nach der gescheiterten Kandidatur von Frau Brosius-Gersdorf eine neue Bewerberin vorgeschlagen hat, die wir nun gemeinsam gewählt haben. Fragen des Lebensschutzes sind Gewissensfragen, auch für mich persönlich.
WELT: Man hatte in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, der CDU fehlte es an innerer und äußerer Konfliktbereitschaft. Muss die CDU für ihre Ideale einstehen, auch wenn es Stimmen kostet?
Volkmann: Schauen wir in die Geschichte der Bundesrepublik: Adenauer setzte die Westbindung und die Wiederbewaffnung durch, obwohl sie unpopulär waren. Beim Nato-Doppelbeschluss war es so, ebenso beim Festhalten am Staatsziel Wiedervereinigung. Gleiches gilt für die Einführung des Euro, die Griechenlandrettung in der Eurokrise oder heute die konsequente Unterstützung der Ukraine. Für mich zeigt das, dass es die Aufgabe der Union ist, das Gemeinwohl unseres Landes über kurzfristige Popularität zu stellen.
WELT: Gilt das auch für das Verhältnis zu Israel?
Volkmann: Deutschlands Platz ist an der Seite Israels und entschieden gegen jede Täter-Opfer-Umkehr bei dschihadistischem Terror. Unsere Staatsräson ist nicht verhandelbar und keine Frage situativer Mehrheiten.
WELT: So klar schien es zuletzt nicht, als Bundeskanzler Merz Waffenexporte an Israel gestoppt hat.
Volkmann: Mit Netanjahus Regierung kann man begründet unterschiedlicher Meinung bei humanitärem Völkerrecht sein, aber an der Staatsräson selbst – das betont auch der Bundeskanzler selbst – gibt es keinen Zweifel.
WELT: Wie könnte ein moderner Konservatismus aussehen, der auf die Zukunft gerichtet ist, ohne die eigenen Wurzeln zu verlieren?
Volkmann: Europaweit stehen christdemokratische Parteien vor derselben Herausforderung: keine „Kuckucksparteien“ zu sein, die, dem konservativen Impuls zu bewahren folgend, brav ausbrüten, was ihnen linke Mehrheiten der Vergangenheit ins Nest legten. Es wäre ein großer Fehler, progressive Narrative, Verwaltungsstrukturen und Programme weiterzuführen, nur weil es kurzfristig der Weg des geringeren Widerstands sein mag. Ich bin beispielsweise Wolfram Weimer dankbar, dass er in der Kulturpolitik klar andere Akzente setzt als seine Amtsvorgängerin. Es braucht einen selbstbewussten Konservatismus, der sich durchsetzt – gerade dann, wenn es Gegenwind gibt.
WELT: Ist Konservatismus eher eine intellektuelle Haltung oder eine politische Praxis?
Volkmann: Beides. Konservatismus ist eine weltanschauliche Grundlage und zugleich eine Richtschnur für das politische Handeln. Oder, um Franz Josef Strauß zu zitieren: Wir sagen, was wir denken, und wir tun, was wir sagen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.