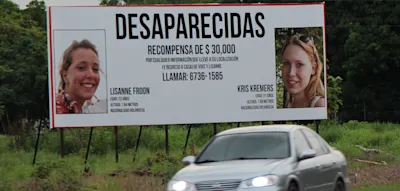Alles hat seine Zeit gehabt. Auch „Minimal“. Die Kunst der absichtsvollen Kunstlosigkeit. Eine artifizielle Praxis, die der kubanisch amerikanische Künstler Félix González-Torres zur frühen Meisterschaft brachte, als er vor über dreißig Jahren eine Industrieproduktion weißlicher Bonbons in durchsichtigen Einwickelpapieren zu einem beachtlichen Rechteck ausstreuen ließ. Heute sieht der Bodendecker aus rund achtzig Kilo Süßwaren wie ein wenig steif gewordener Flokatiteppich aus. Und so richtig lässt sich die seltsame Mischung aus Irritation und Faszination nicht mehr nacherleben, die die minimalistische Kunstübung einst ausgelöst hat.
Wir sind zur Auffrischung der Erinnerung nach Paris gereist, wo der Milliardär und Großsammler François Pinault die Bonbon-Vorräte hütet und sorgsam darüber wachen lässt, dass ihnen niemand zu nahekommt. Es ist in seinem Privatmuseum, in der von dem japanischen Architekten Tadao Ando fantastisch aufgefrischten alten Bourse de Commerce, wie ein Fest der abgesunkenen, aber noch immer nachleuchtenden Minimal-Jahrzehnte.
Wohl gibt es derzeit keinen zweiten Ort, an dem das visuelle Magerprogramm so umfassend und weltumspannend rekapituliert wird. Nachdem die Sammlung des Mailänder Immobilienhändlers Giuseppe Panza di Biumo ihre Geschlossenheit verloren hatte, hat Pinault die Alpha-Rolle übernommen. Und zusammen mit Leihgaben vieler Museen gestattet seine einzigartige Collection einen veritablen Epochenüberblick.
Minimal-Art oder die Sehnsucht nach Verknappung
Was war es denn, was Künstler mit einem Mal aus den Traditionsspuren ausbrechen und auf ihre gewohnten Überbietungen verzichten ließ, auf malerische Grandezza, auf die überwältigende Ikonik, mit der sie so verlässliche Triumphe feierten? Die Minimal-Anfänge reichen zurück in die 1960er-Jahre, deren Fortschrittsstimmung sich volksnah in der bunten Diesseitigkeit der Pop-Art spiegelte. Aber eben auch die Sehnsucht nach Verknappung, Bescheidung, Rückführung und Wiederverrätselung der künstlerischen Mittel nährte.
So war die neu proklamierte Erscheinungsarmut der Kunst gegen die Atemlosigkeit optischer Reize gesetzt. Verlangt war Konzentration, gebündelte Aufmerksamkeit. Statt Sensation die Sinnlichkeit von Präzision und System. Statt retinaler Befriedigung Kopfarbeit und visuelle Nachdenklichkeit. Statt Handschrift die apparative Logik. Statt auratischer Schöpfungsakte schlichte Ausführungsbestimmungen – abzugeben in der Fabrik oder beim Großhändler weißlicher Bonbons in durchsichtigem Einwickelpapier.
Wobei das minimalistische Sittenbild übersieht, dass die Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Beweggründen zu ihrem Job gekommen sind und sich von ganz eigenen kontinentalen Traditionen lösen mussten. Die „Zero“-Nagelbilder des Günther Uecker haben ihren offensichtlichen Ursprung in der dominierenden informellen Malerei der Nachkriegs-BRD, während der Amerikaner Dan Flavin mit seinen fluoreszierenden Leuchtröhren das künstliche Licht der erleuchteten Metropole zum Kunstlicht im Museum adelt.
Von einer minimalistischen Sonderklasse, gar Bewegung zu sprechen, wäre also doch etwas heikel. Zumal es die Ausstellung mit den Abgrenzungen zur sogenannten Land-Art oder zur Konzeptkunst nicht allzu genau nimmt. Auch scheinen die Denk- und Empfindungsstrecken zwischen den seriellen Spielereien eines François Morellet und den Datumsbildern des On Kawara, die sich auf politische Ereignisse beziehen, nicht gerade unbeträchtlich.
Wider die maskuline Dominanz
Jeder erzählt in der Pariser Revue seine eigene Geschichte. Und der Reiz liegt nicht zuletzt in der Grandezza, mit der sie die Widersprüche inszeniert und aushält. Schwer zerren die Holzblöcke an ihren Seilen, die der Düsseldorfer Bernd Lohaus Ende der 1960er an die Wände hing. Und man fürchtet gleichsam um die Unversehrtheit des feinen Fadengespinsts in der Nachbarschaft, das der Japaner Jiro Takamatsu auf dem Boden wuchern lässt.
Wohl ist es der veränderten Geschichtserzählung zu verdanken, dass nun auch innerhalb des Minimal-Zirkels die maskuline Dominanz gebrochen ist. So schließen die neuen kuratorischen Vorlieben nicht wenige der ehemaligen Helden aus: Weder Carl Andre noch John McCracken, weder Fred Sandback noch Robert Grosvenor oder Robert Morris haben es in die Auswahl geschafft. Dafür hat Meg Webster ihren singulären Auftritt.
Der Grande Dame aus San Francisco ist der riesenhafte Rundhof der Bourse als Bühne reserviert, wo sie ihre elementaren Formen aus Naturmaterialien installiert hat. Einen Kegel aus Salz, eine Halbkugel aus Erde, eine hohle Wand aus Bienenwachs, eine Höhle aus Buschwerk. Es ist wie Besuch auf einem anderen Planeten, dessen Oberfläche wieder in ihre ursprünglichen Formen zerfallen ist. Jedenfalls erinnert einen der kolossale Auftritt der inzwischen über achtzig Jahre alten Künstlerin daran, dass der Blütenstaubsammler und Wachshaus-Former Wolfgang Laib nicht das Weltmonopol in Sachen künstlerischer Naturbaustoffe besitzt.
Ganz am Ende der Ausstellung, wo sie sich schon ein wenig in der geflissentlichen Aufzählung erschöpft, stellt sie sich im Gastspiel der Brasilianerin Lygia Pape noch einmal zum großen Erlebnis auf. Auch ihr singuläres Werk ist ganz ähnlich wie der Formenkosmos der Meg Webster erst in den vergangenen Jahren entdeckt und entsprechend gewürdigt worden. Zumindest in Europa, wo die „Arte concreto“ Lateinamerikas lange nur auf peripheres Interesse stieß. Wobei es beileibe nicht so ist, dass sich die Künstlerin mit spitzen und rechten Winkeln zufriedengegeben hätte. Ihre „Tecelar“-Holzschnitte auf Japanpapier mit Flächen aufgelöster Kuben, kriechen wie fliehende Ameisenschwärme über die Wände.
Während ein wackliges Video zeigt, wie Pape aus einer am Meer abgestellten Papierhütte in einem Akt selbstgeburtlicher Anstrengung schlüpft, während auf großer Leinwand die Teilnehmer einer Performance unter einem bis auf die Köpfe alles abdeckenden Tuch zum „neokonkreten Ballett“ animiert werden. Und nebenan, ganz hinten herrscht erhabenes Schweigen, wo im dunklen Raum ein Dutzend rechteckiger Bündel Goldfäden schräg zwischen Decke und Boden gespannt sind, dass es aussieht, als breche das Sonnenlicht durch ein Gitter ins Verlies.
Ein Rückblick also, vielleicht auch ein Neuversuch mit einem Kunstprogramm, das, obschon seine Entstehung vielfach bezogen blieb auf die vertrauten industriellen Produktionsweisen, letztlich unzugänglich schien und auch unter den willigen Parteigängern der Avantgarde nur partielles Engagement mobilisieren konnte. Zum Massenzuspruch schien „Minimal“ nie geeignet, und Beachtung fanden die kargen Kunstangebote auch erst spät, als offenkundig geworden war, wie viel fatales Einverständnis doch in der Pop-Art die heraldische Inszenierung der Konsumkultur barg.
Wohl sind die Banalgegenstände nicht wieder gegen künstlerische Luxusthemen eingetauscht worden, aber die Würde, die die minimalistisch arbeitenden Künstlerinnen und Künstler ihren elementaren Werken mitgaben, hat ihrem Programm eine spirituelle Unverfügbarkeit geschaffen, wie sie der Pop-Art längst nicht mehr eignete. Unversehens ist die Kunst der Geheimnislosigkeit wieder zum Geheimnis geworden. Und rasch hat man gelernt, dass ein Kegel aus Salz im Grunde nicht weniger rätselhaft ist als die Ranküne, mit der die kubistischen Maler den Körper zerlegt haben.
„Kein Ende der Möglichkeiten, niemals“
Minimal wollte ganz neu beginnen, die Kunst an ihre vermuteten Ursprünge zurückbringen und von ihren Ursprüngen aus neu begründen. Und es wäre nicht mit rechten Kunstdingen zugegangen, wenn die erklärte Bescheidung sich nicht in stolzen Ansprüchen verborgen hätte. Einen großen Auftritt in Paris hat auch Robert Ryman, der ein Leben lang nichts anderes tat, als spachtelig weiße Farbe auf farbig grundierte Bildquadrate aufzumalen.
Ob es verboten sei, an weißen Schnee oder an weiße Blumen zu denken, haben wir ihn einmal gefragt. „Verboten nicht“, war des Weiß-Meisters Antwort. „Aber ich denke schon, dass man so das Wesentliche verkennen würde. Es sind eben keine Bilder, die über irgendein Weltverhältnis Auskunft geben wollen. Nichts verführt zur Illusion. Was weiß ist an ihnen, ist Anleitung zum Sehen. Das ist es.“
Aber, ob er keine Befürchtungen habe, dass der Weiß-Vorrat einmal zu Ende gehen, dass er zur Wiederholung gezwungen sein könnte? „Nein“, die Sorge habe er noch nie gehabt. „Es gibt kein Ende der Möglichkeiten, niemals.“ Robert Ryman ist 2019 gestorben. Alles hat seine Zeit gehabt. Auch „Minimal“.
„Minimal“, bis zum 26. Januar 2026, Pinault Collection, Bourse de Commerce, Paris
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.