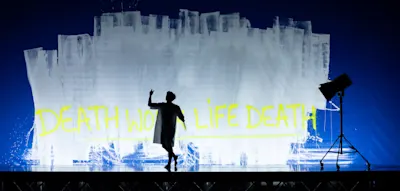Salman Rushdie hat nie einen Chatbot benutzt. Angst müssten Autoren aber auch nicht haben vor der Künstlichen Intelligenz (KI), sagte er im Juni beim walisischen Hay Festival. Doch Vorsicht: „Sollte es je ein lustiges Buch von ChatGPT geben, sind wir verloren“, zitiert ihn der „Guardian“. Witzig? Für Sarah Silverman wohl kaum. Die US-Komikerin beteiligte sich 2023 an zwei Sammelklagen gegen Chatbot-Anbieter. Dabei ging es nicht darum, dass eine KI, also ein sogenanntes großes Sprachmodell (LLM), einen Witz à la Silverman machen kann (kann sie). Sondern warum.
Nämlich nur, weil sie auf Silvermans Texte und Filme im Netz zugegriffen hat. Doch die Beklagten hätten ihre LLMs ohne Einverständnis der Rechteinhaber mit deren Daten trainiert. Oder, pikanter, mit Material aus sogenannten Schattenbibliotheken – Library Genesis etwa bietet kostenlosen Zugriff auf Millionen Texte.
Spitzentechnologie sei heute von „Massendiebstahl“ angetrieben, schrieb Alex Reisner 2023 im „Atlantic“. Bislang habe die Piraterie-Kultur eher persönlichen Zwecken gedient, nicht Profiten. Wenn KI-Anbieter auf LibGen und Co. zugreifen, geht es aber zunächst ums Geld, wie der Investigativjournalist anhand von E-Mails aus dem Tech-Konzern Meta, wo der Chatbot LLaMA zu Hause ist, aufzeigen konnte. Mitarbeiter hätten zwar mit Unternehmen über die Lizenzierung von Büchern und Forschungsarbeiten gesprochen. Doch, so der Befund in einem internen Unternehmenschat, sei das „unangemessen teuer“. Und, wichtiger: Man könne sich nicht auf die Fair-Use-Strategie berufen, „wenn wir ein einzelnes Buch lizenzieren“.
„Fair Use“ ist das Zauberwort. Es bezeichnet im US-Copyright etwa das, was in Deutschland „Schranken des Urheberrechts“ sind. Zwar hat ein Autor ein ausschließliches Nutzungsrecht an den Früchten seiner Arbeit, aber in bestimmten Fällen haben auch andere Ansprüche. Das betrifft etwa Zitate oder Kopien für den Lehrbetrieb, die, so sagt es das Gesetz, „keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben.“ Würde ein KI-Unternehmen also einen Vertrag über auch nur ein einziges Werk schließen, wäre von da an kaum noch darstellbar, warum das nicht für alle Texte gilt.
2025 wurden Silvermans Klagen, der sich auch namhafte Schriftsteller wie Jonathan Franzen und „Game-of-Thrones“-Erfinder George R. R. Martin angeschlossen hatten, abgelehnt. Interessant ist, dass ein Richter zwar feststellte, dass die Praxis, sich an Werken aus Schattenbibliotheken zu bedienen, schwerlich als „Fair Use“ gelten könne. Doch der Beweis, dass Texte, die eine KI ausspuckt, keine neuen Werke seien, nicht erbracht, so der Richter. Genauso wenig hätten die Kläger beweisen können, dass die KI-Texte eine Konkurrenz für ihre Arbeiten darstellten. „Bartz vs. Anthropic“ heißt ein weiteres von inzwischen vielen ähnlichen Verfahren, das gerade in einem Vergleich endete.
3000 Dollar pro Buch
In der kurzen Geschichte der Autorenaufstände gegen KI-Giganten sucht er seinesgleichen. Thriller-Autorin Andrea Bartz hatte bemerkt, dass Anthropic seinen Bot Claude auch mit ihren Büchern trainiert hat, schreibt sie in der „New York Times“. Und sie hat ChatGPT gebeten, eine Story im Bartz-Stil zu verfassen. Es klang, kein Witz, wie ein Text von ihr. Dass der zuständige Richter befand, Anthropic habe mit Wissen seiner Führungskräfte riesige Mengen Bücher aus Bibliotheken heruntergeladen, die Raubkopien enthielten, führte wohl zum Vergleichsangebot: Anderthalb Milliarden Dollar ist sein Volumen, 3000 Dollar pro Buch. Entschieden wurde aber auch, dass das Training von LLMs, solange die dafür verwendeten Bücher legal erworben wurden, einen Fall von „Fair Use“ darstellt. Dabei gehe es, siehe die Abkürzung „GPT“ (für „generativer vortrainierter Transformer“), eben um Transformation, nicht um eine Kopie. Was viele Autoren bestreiten.
Eine außergerichtliche Einigung ist kein juristischer Präzedenzfall. An einer rechtlichen Regelung scheinen weder die Tech-Industrie noch die US-Regierung interessiert. Schon 2023 vermutete Sheera Frenkel („Inside Facebook“), dass die US-Regierung vor Restriktionen zurückschreckt, weil das im „KI-Wettrüsten“ mit China nicht opportun ist.
Auch in Europa heißt es jetzt: Mensch oder Maschine. Im März meldete das Portal „France 24“, französische Autoren- und Verlegerverbände hätten Meta verklagt. In Schweden forderten Autoren, darunter Bestsellerautorin Malin Stehn, für eine ähnliche Klage von Kultusministerin Liljestrand Rückendeckung. Das finanzielle Risiko eines Gerichtsverfahrens sei allein zu groß. In Deutschland wächst die Sensibilität für den Schaden durch KI-Raubzüge im Netz. Eine Paneldiskussion des Börsenvereins auf der Buchmesse spricht dafür.
Aber auch, dass Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer den „Raubzug“, der vom Silicon Valley und chinesischen KI-Firmen ausgehe, zum Messethema Nummer eins erklärte: „Auf gleichsam vampiristische Weise saugen KI-Unternehmen das kreative Potenzial aus unzähligen klugen Köpfen, nutzen deren Ideen und Empfindungen, ihre Schaffenskraft, ihre Visionen. Damit wird die große kulturelle Errungenschaft autonomer Kunstwerke und vor allem Bücher zur bloßen Beute“, so der Minister bei der Eröffnung der Messe am 14. Oktober in Frankfurt. Deutschland und Europa dürften „der systematischen Verletzung von Urheberrechten“ nicht tatenlos zusehen, man brauche eine Regulatorik. Weimer brachte auch einen „Plattform-Soli“ ins Gespräch.
Den Anthropic-Vergleich interpretiert der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins gegenüber WELT AM SONNTAG als „ein gutes und wichtiges Signal, das Rechteinhabern den Rücken stärkt und KI-Unternehmen endlich in die Pflicht nimmt – auch wenn er auf europäisches und deutsches Recht leider nicht direkt übertragbar ist.“ Der Fall habe „hoffentlich eine Vorbildfunktion für unsere Regierung“, so Peter Kraus vom Cleff: „Wir brauchen auch hier klare Transparenzpflichten für KI-Unternehmen. Nur mit Offenlegung der Trainingsdaten können sich Rechteinhaber gegen die ungefragte Nutzung ihrer Werke überhaupt zur Wehr setzen.“
„Kreativität in der digitalen Zukunft stärken“
Ein Echo der schwedischen Bedenken hört man beim Verleger Jonathan Beck vom Verlag C.H. Beck: Klagen gegen die illegale Nutzung, auch von Werken vieler Beck-Autoren, seien nur in den USA möglich, aber erschienen angesichts der aktuellen US-Politik nicht aussichtsreich. „Das damit verbundene finanzielle Risiko überschreitet auch die Mittel der deutschen Buchverlage, deren jährliche Erlöse weniger als zwei Prozent des aktuellen Unternehmenswerts von OpenAI entsprechen“, so Beck gegenüber WELT AM SONNTAG. Er hofft, wie Kraus vom Cleff, auf „eine Offenlegungspflicht der von KI-Unternehmen genutzten Quellen.“
Kiepenheuer & Witsch-Verlegerin Kerstin Gleba fürchtet, ohne „klare rechtliche Grundlagen und die Unterstützung der Politik“ werde Kultur „zum kostenlosen Trainingsmaterial“. Gleba zeigt sich aber technologieoffen: „Klare Vertragsregelungen können Autor:innen und Verlagen ermöglichen, an neuen Erlösmodellen im Bereich KI teilzuhaben – und so Kreativität auch in der digitalen Zukunft zu stärken“, sagt die Kölner Verlegerin.
Ralf Tornow, Geschäftsführer bei Klett-Cotta, betont WELT AM SONNTAG gegenüber die disruptiven Auswirkungen von KI vor allem auf Ratgeber- und Kinderbuchverlage. Je komplexer die Werke, desto weniger schienen sie derzeit noch bedroht, was aber aufgrund der Lerngeschwindigkeit der KIs „aber ein gefährlicher Trugschluss“ sein könnte. In Stuttgart versuche man, seine Werke seit einiger Zeit rechtlich gegen die Verwendung als Trainingsinhalt zu schützen. Ob dies aber funktioniere, bleibe abzuwarten: „Gerichte mögen zugunsten von Autor:innen oder Rechteinhabern entscheiden, aber im Grunde sind die verwendeten Daten unbezahlbar und die Profiteure stehen bereits fest.“ Von der Politik erwarte man, „dass Urheberrechte und geistiges Eigentum unserer Autor:innen und auch von uns als Verwertern der Rechte zeitgemäß geschützt werden.“ Tornow bleibt skeptisch: „Dass dies schwierig sein wird, zeigt allerdings ein Blick in die Vergangenheit.“
Open Source, aber Lizenz
Wie sehr die Entwicklungen, die zum modernen Urheberrecht führten, unser Bild von Autorschaft und Literatur prägten, hat der Freiburger Germanist Heinrich Bosse schon 1981 gezeigt. Sein Buch „Autorschaft ist Werkherrschaft“ ist noch immer eine luzide Analyse – und eine unschätzbare Fundgruppe für Ansichten zu (wieder) heutigen Problemen. Moralisch hätten viele Autoren noch Ende des 18. Jahrhunderts den Nachdruck zwar abgelehnt, schreibt Bosse, sie sprachen aber dem Staat das Recht ab, ihn zu verbieten. „Drucken ist nichts anderes, als öffentlich nacherzählen“, zitiert Bosse den Freiherrn von Knigge: „Ja! Wenn ich sogar das, was ich erhorcht habe, drucken lassen will: so kann die Regierung meine Schelmerey nicht bestrafen.“
Der Nachdruck nämlich fördere „das Lesen und folglich die Aufklärung“, erklärt Bosse. Das historische Argumentationsmuster erinnert an heutige Befürworter von Schattenbibliotheken, die meinen, nur unter Umgehung oft teurer Fachverlage könne man das gesammelte Wissen dieser Welt allen zugänglich machen. Und an eine Koinzidenz, die die Schweizer Historikerin Monika Dommann 2014 in ihrer Studie „Autoren und Apparate“ betont hat: Etwa zeitgleich mit wettbewerbspolitischen Überlegungen des US-Juristen Stephen Breyer, wonach ein Copyright bei Computerprogrammen es kleineren Unternehmen schwer mache, mit Giganten wie IBM zu konkurrieren, fragte man im intellektuellen Paris, wie Michel Foucault, was das überhaupt sei, ein Autor – oder beerdigte ihn, wie Roland Barthes, gleich ganz.
Dass Metas LLM zwar Open Source ist, aber Entwickler dazu gedrängt werden, einer Lizenz zuzustimmen, während Meta-Boss Mark Zuckerberg die „Werkherrschaft“ von Schriftstellern mit Füßen tritt, wirkt da ironisch. Lachen kann in der Buchbranche wohl keiner darüber.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.