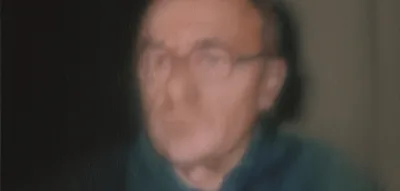Um Josef Mengele, den untergetauchten „Todesengel von Auschwitz“, rankten sich zu Lebzeiten Legenden. Die seit seinem Tod bekannt gewordenen Fakten über sein angebliches Verschwinden sind spannend wie mancher True-Crime-Podcast. Um daraus einen Film von erstickender Langeweile zu machen, wie es Regisseur Kirill Serebrennikow und seinem Team gelungen ist, gehört ein Wille zur Ästhetisierung, die bei einem anderen Sujet vielleicht bewundernswert wäre.
Möglicherweise aber wollte der aus Russland stammende Serebrennikow mit „Das Verschwinden des Josef Mengele“ die Parodie eines typischen deutschen Arthouse-Films abliefern, in dem Bilder die Handlung ersetzen, Gekünsteltes als Kunst durchgeht, die Missachtung des Publikums und seines Bedürfnisses nach einer verständlichen Erzählung als Ausweis filmischer Qualität und Förderungswürdigkeit gilt. Das wäre ihm gelungen.
Fabrikantensohn und Massenmörder
Josef Mengele war als SS-Arzt im Vernichtungslager für die Selektionen zuständig. Er entschied, wer nach der Ankunft im KZ sofort in der Gaskammer oder erst nach und nach durch Arbeit getötet werden sollte. Außerdem führte er sadistische und pseudowissenschaftliche Experimente an Zwillingen und Menschen mit genetisch bedingten Missbildungen durch. „Beppo“ war außerdem ein liebender Sohn, Ehemann und Vater.
Nach dem Krieg gelang es Mengele, bei Bauern in der Nähe von Regensburg unterzutauchen. Derweil machte seine Frau Irene den amerikanischen Ermittlern erfolgreich vor, ihr Mann sei an der Ostfront gefallen. 1948 setzte er sich über die „Rattenlinie“ nach Argentinien ab, wo der Nazi-Fliegerheld Hans-Ulrich Rudel das „Kameradenwerk“ zur Unterstützung ehemaliger Kriegsverbrecher und neuer Nazis gegründet hatte und dem Populisten Juan Peron als Militärberater diente. Dort fanden sich weitere NS-Mörder wie Adolf Eichmann und Erich Priebke ein.
Mengele konnte auf großem Fuß leben, da ihn seine Familie – der die Landmaschinenfabrik „Mengele Agrartechnik“ im schwäbischen Günzburg gehörte – finanziell unterstützte. 1959 fühlte er sich so sicher, dass er bei der deutschen Botschaft in Buenos Aires einen Pass mit seinem echten Namen beantragte und eine Reise nach Deutschland plante.
Unbehelligt bis zu seinem Tod
Freilich hatte sich in der Bundesrepublik inzwischen einiges geändert. Die Öffentlichkeit war nicht zuletzt durch die Veröffentlichung des Tagebuchs der Anne Frank 1955 sensibler geworden für den Völkermord an den Juden. 1958 veröffentlichte der Journalist Ernst Schnabel eine Biografie Anne Franks. Als ein Auszug in einer Ulmer Zeitung erschien, schrieb eine Leserin – vielleicht ein ehemaliges Hausmädchen der Mengeles – einen anonymen Brief an die Zeitung, in dem sie auf die Komplizenschaft der Familie bei der Flucht Mengeles hinwies und seinen Aufenthaltsort verriet. Auf Initiative Schnabels wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den KZ-Arzt eröffnet, dessen Anschrift in Buenos Aires der Staatsanwaltschaft ausweislich der Akten bekannt war.
Mengele konnte jedoch vermutlich dank aktiver Hilfe argentinischer Stellen 1960 nach Paraguay und von dort nach Brasilien fliehen, wo er, obwohl die dortige Polizei spätestens 1963 wusste, mit wem sie es zu tun hatte, bis zu seinem Tod 1979 unbehelligt unter falschem Namen lebte.
Von alledem erfährt man in Serebrennikows Machwerk fast nichts, das im Kern eine cineastische Liebeserklärung an August Diehl ist, der Mengele spielt. Fasziniert umschleicht die Kamera Diehls Mengele, wenn er mit seinen Hunden in der Pampa auf Jagd geht, fachgerecht ein Schwein zerlegt, sich ausgiebig duscht, den Schnurrbart kämmt, mit seiner aus Deutschland eingeflogenen zweiten Frau und mit der Frau eines seiner Gastgeber etwas unappetitlichen Sex hat, sich von einem Hausmädchen einen Handjob geben lässt und so weiter.
Freilich folgt der Film hier seiner Vorlage: „Möchten Sie wissen, was Josef Mengele für Sonderwünsche hatte, wenn er im südamerikanischen Exil zu einer Prostituierten ging? Oder worin für ihn das Vergnügen lag, die Witwe seines Bruders zu heiraten? Dann sind Sie bei Olivier Guez richtig.“ So Christoph Vormweg im „Deutschlandfunk“ über Guez‘ Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“. Wer das nicht wissen möchte, ist eben im falschen Film.
„Serebrennikov erzählt auch vom nachlässigen Umgang der deutschen Behörden, der deutschen Bevölkerung mit der eigenen Geschichte, von Lebenslügen und billigen Ausreden und davon, ob der deutsche Umgang mit der Vergangenheit wirklich so vorbildlich und vor allem erfolgreich war, wie es oft heißt.“ So Michael Meyns im „Magazin der Arthousekinos“. Eben nicht. Davon ist im Film nicht die Rede.
Meyns behauptet auch, für Mengele sei es mit dem Verdrängen seiner Verbrechen vorbei gewesen, als ihn sein Sohn „Rolf, ein Hippie, ein Linker“, in den 1970er-Jahren besucht, „geprägt von den Entwicklungen der Studentenbewegung, dem Verlangen an die Eltern-Generation, sich endlich der eigenen Vergangenheit, der eigenen Verantwortung zu stellen.“
Das suggeriert der Film in der Tat. Aber ganz davon abgesehen, dass sich die linken Studenten entgegen den eigenen Lebenslügen für alle möglichen Nazi-Verbrechen, nur nicht für den Holocaust, interessierten und den Antizionismus in Deutschland hoffähig machten: Der 1944 geborene Rolf – etwas zu alt, um in den 70ern ein Hippie zu sein – funktionierte als Kurier, überbrachte Gelder von der Familie und versuchte nach dem Tod des Vaters dessen nachgelassene Briefe und Tagebuchaufzeichnungen zu Geld zu machen.
Nazis sell. Nazis faszinieren. Nazis in Uniform, Nazis im Bett. Nazis in Aktion, Nazis im Exil. Und Nazis garantieren Fördergelder, die auch für diesen voyeuristischen Film reichlich flossen. Weil man die eigene Faszination immer als Aufklärungswillen ausgeben kann, auch wenn, wie in diesem Film, nichts aufgeklärt wird. „Serebrennikov erzählt in berückenden Schwarz-Weiß-Bildern des Film Noir samt seinen Lichtreflexionen, unterlegt sie mit dem passenden jazzigen Score bzw. der Location und Stimmung entsprechend mit Tango-Klängen“, so Heike Angermaier in „Blickpunkt: Film“. Genau. Darum geht es. Um berückende Bilder, Jazz und Tango und dazu ein bisschen Wohlfühl-Naziverachtung, denn wir, gell, wir sind ganz anders. Man sieht sich auf der Demo gegen Israel.
„Das Verschwinden des Josef Mengele“ läuft ab dem 23. Oktober 2025 im Kino.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.