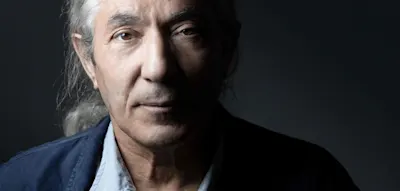Ach, war das schön, all die fröhlichen Fans in ihren Jerseys zu sehen. Sie tanzten zu ASAP Rocky im Kreis, ließen sich von Chio-Chips-Kanonen abschießen und grölten Arm in Arm zu Musik von John Denver: „West Virginia, mountain mama“. Manche Paare trauten sich auch knutschend vor die Kiss-Cam. Keine Aggression im Stadion, höchstens ein paar liebevolle Mittelfinger zur anderen Kurve, die dort mit genau demselben Grinsen beantwortet wurden.
Am vergangenen Sonntag waren 72.000 Football-Fans aus aller Welt ins Berliner Olympiastadion gepilgert, um hier auf ausverkauften Rängen muskelbepackte Männer auf dem Feld anzufeuern. Die Colts aus Indianapolis und die Falcons aus Atlanta waren auf Anweisung der NFL-Bosse für einen Spieltag nach Deutschland gereist, um hier ihren Sport zu vermarkten. Die National Football League ist die größte Sportliga der Welt und will also noch größer werden. Dafür werden eben auch elf Flugstunden in Kauf genommen.
Im deutschen Fußball würde eine solch schamlose Selbstvermarktung im Regel-Spielbetrieb für Proteststürme unter Fans sorgen. Niemals könnten sie akzeptieren, dass „ihr Fußball“ ans Kapital verkauft wird. Dementsprechend sagte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auch: „Dass wir ein Meisterschaftsspiel im Ausland machen würden, das sehe ich ehrlich gesagt nicht und das möchte ich auch nicht.“ Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ergänzte: „Die Bundesliga gehört nach Deutschland.“
Interessant ist es schon, wie Deutschland in der Vermarktung seines liebsten Kindes durch die Gegend eiert und sich selbst belügt. Der Spitzenfußball ist jetzt schon bis in die letzte Ecke durchkapitalisiert. Eigentlich ging das schon los mit der Einführung von Trikotwerbung. Im März 1973 lief Eintracht Braunschweig erstmals mit Jägermeister-Logo auf – das ließ sich der Klub 100.000 Mark jährlich kosten. Dann ging 1991 der Bezahlsender Premiere an den Start und zeigte Fußballspiele hinter der Paywall. Mittlerweile heißen Fußballstadien wie Versicherungsunternehmen, Spieler sind durch Social Media größere Marken als ihre Vereine – und um einen ganzen Bundesligaspieltag zu schauen, benötigt man mehrere Abos gleichzeitig von Dazn, Sky und Co.
Während also längst Investoren und internationale Sponsoren kräftig mitbestimmen, verzieht sich der gemeine Fußballfan in einen romantisierten Traditionsdiskurs, der ihm die Illusion von Mitbestimmung eintrichtert. Es ist eine Dissonanz, ein eigentlich zum Himmel schreiender Verdrängungsreflex, der aber einen validen Schmerz offenlegt: Man konsumiert als Fußballfan eigentlich längst wie ein Kunde, will doch aber gleichzeitig als Mitglied der Gemeinschaft adressiert werden.
American Football ist in dieser Hinsicht völlig unideologisch. Die NFL nimmt die Beziehung zwischen Fan und Produkt ernst, indem sie es nicht verklärt. Entertainment und Zugehörigkeitsgefühl werden hier nicht getrennt voneinander gedacht, sondern gehen fließend ineinander über. Das sieht man allein schon daran, wie spielerisch Fan-Identität in der NFL verhandelt wird. Junge und erwachsene Zuschauer wählen ziemlich willkürlich einen Lieblingsverein aus, den sie unterstützen. Die sakrale Überhöhung des Fußballs, nach der man schon bei Geburt den Verein durch den Vater zugewiesen bekommt und ihn niemals wechseln darf, dürfte hier als lächerlich und verkrampft aufgefasst werden.
Für eine Gegenwart, die Identität viel zwangloser spielt, ist das Popkulturprodukt NFL ein anschlussfähiger Trend. Zumal die amerikanische Sportliga auch modisch Maßstäbe setzt. Das Einlaufen der NFL-Spieler in die Katakomben des Stadions hat Laufsteg-Charakter: Popcorn raus, die Show kann beginnen. Aber deutsche Fußballfans, die bekanntlich gerne mit Extravaganz fremdeln, versteigen sich häufig noch in kleinliche Ressentiments und kritisieren Nationalspieler Leroy Sane, wenn er mit Louis Vuitton-Tasche zum Treffpunkt kommt.
Dabei kann es auch befreiend sein, den Event-Charakter des Spitzensports endlich anzuerkennen. Wenn man mal vollumfänglich akzeptiert, dass man im ganzen Spektakel sowieso nur Kunde ist, feiert es sich eigentlich ganz beschwingt. Der Fußball, der auf tragische Weise noch versucht, seinen Kapitalismus zu verschleiern, könnte davon lernen.
Das Thema wurde zuerst im WELT-Popkulturpodcast „hyped“ besprochen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.