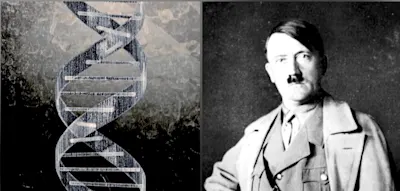Seit die Regierungsparteien am Donnerstag das neue Wehrdienstgesetz beschlossen, wabert mehr denn je das Wort „kriegstüchtig“ durch die Plenarsäle, Redaktionen und Talkshows des Landes. Folglich hätte die am Samstagvormittag im Rahmen des noch jungen Berliner Philosophie-Festivals „Philo.live!“ stattfindende Diskussion mit dem Titel „Sterben für den Staat?“ kaum aktueller sein können.
Eine Pointe dazu gleich vorweg: die zweite Ausgabe des „Philo.live!“ findet dieses Jahr auf dem Gelände des ehemaligen Krematoriums im Wedding statt, das mittlerweile „silent green Kulturquartier“ heißt und vor wenigen Jahren umgewidmet und umfassend renoviert wurde. Die Bühne, auf der Sönke Neitzel, Militärhistoriker und seit Kriegsausbruch reger Talkshowgast, und der Philosoph Olaf L. Müller lebhaft übers Sterben fürs Vaterland diskutieren, ist dabei ausgerechnet in der ehemaligen, unterirdisch gelegenen Leichenhalle untergebracht, zu der man über eine lange, abwärts führende Betonrampe gelangt. „Highway to hell“ oder „Stairway to heaven“ also, je nach Blickwinkel.
Bekenntnis zum Pazifismus
Müller, der Philosoph, eröffnet nach einem kurzen Grußwort von Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des „Philosophiemagazins“, direkt mit einem Bekenntnis zum Pazifismus. Dabei legt er Wert darauf, mit dem Zerrbild von Pazifisten als „Leuten mit Waffenallergie und in Jesuslatschen“ aufzuräumen. Er selbst habe noch an der Waffe gedient, „weil ich nicht christlich rumheucheln wollte“, wie er sagt. Er gibt sogar zu, dass das gar nicht so ein schlechtes Gefühl gewesen sei, eine Waffe in der Hand zu halten und abzufeuern – „aber natürlich nicht auf Menschen.“
Müller ist also kein Fundamentalist, vielmehr vertritt er einen „pragmatischen Pazifismus“. Dieser beginne damit, dass man zunächst die Wirklichkeit betrachte und sodann im zweiten Schritt in der Geschichte nach Ereignissen suche, in denen ein friedlicher Ausweg aus einem Konflikt gelungen sei. „Pazifismus bedeutet für mich, nach genau solchen historischen Fenstern zu suchen und sie aufzustoßen.“
Der an diesem Vormittag leicht verschnupfte Neitzel erzählt eingangs, dass er während seiner Schulzeit der einzige in seiner Klasse gewesen sei, der eine positive Haltung zum Nato-Doppelbeschluss, zur Bundeswehr und zum Militär allgemein gehabt habe. Bis zum Ukraine-Krieg sei er mit seinen Meinungen eigentlich immer in eklatanter Minderheit gewesen, was sich plötzlich schlagartig verändert habe. „Interessant, dass selbst viele meiner linken Berliner Galeristenfreunde, die früher verweigert haben, jetzt sagen, dass sie das nicht mehr machen würden“, meint er und schmunzelt.
Lage heute kritischer als im Kalten Krieg
Was den pazifistischen Ansatz Deutschland angeht, so vertritt Neitzel schon immer aus voller Überzeugung das aus dem Kalten Krieg bekannte Prinzip der Abschreckung. Müller hakt von der Seite ein. Er verwahrt sich gegen die Ansicht, dass die Abschreckung im Kalten Krieg wirklich kausal dafür gewesen sei, dass der Konflikt zwischen Nato und Warschauer Pakt friedlich gelöst wurde. Es werde ausgeblendet, wie gefährlich das alles gewesen sei. Dass ein so besonnener und moderater Politiker wie Gorbatschow damals an der Macht war, bezeichnet Müller als „Zufall der Geschichte“; bei einem anderen Machthaber hätte es genauso gut zum großen Knall kommen können. Angesichts der beiden Hochphasen des Kalten Kriegs – der Kuba-Krise und dem Jahr 1983, in dem die Sowjets ernsthaft glaubten, US-Präsident Reagan plane einen Nuklear-Angriff – „hatten wir mindestens zweimal einfach nur Glück“, so Müller. Aktuell befänden wir uns in einer dritten Krise, in der wir es mit einem „Gangster im Weißen Haus“ und einem „zickigen Zaren im Kreml“ zu tun hätten und dennoch ein weiteres Mal auf unser pures Glück vertrauten.
Widerspruch von Neitzel, die Kuba-Krise sei für ihn zum Großteil ein „Produkt von Fernsehproduktionen“ gewesen. Zustimmung indes zur Gegenwart: „Heute ist die Lage noch kritischer als im Kalten Krieg. Damals ging es in Europa um die Bewahrung des Status quo, nicht um Veränderung. Heute säße jedoch im Kreml jemand, dem es gerade um Revision und Veränderung gehe.“
Singen gegen den Atomkrieg?
Moderator und Journalist Friedrich Weißbach, der bei dem regen Schlagabtausch der beiden Diskutanten wenig zu tun hat, möchte wissen, ob ein Einsatz von Atomwaffen denkbar und womöglich auch moralisch vertretbar sei. Laut Neitzel gebe es derzeit keinen Analysten, der wirklich davon ausgehe, dass es zu einem umfassenden nuklearen Schlagabtausch zwischen den USA und Russland kommen werde.
Müller weist auf die vertrackte Lage in der Ukraine hin. So hätten ausgerechnet die Waffenlieferungen der Europäer, allen voran Deutschland, die Gefahr eines nuklearen Erstschlag seitens Russland im Herbst 2022 noch einmal signifikant erhöht. Man könne den Ukrainern daher nur so viel liefern, dass sie einerseits gerade so durchhalten, andererseits aber den Krieg auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen. Das sei das Dilemma dieses Konflikts, der mittlerweile zu einem Abnutzungskrieg geworden sei. Dabei geht Müller auch gerade mit der ehemaligen deutschen Regierung hart ins Gericht und beklagt den „Gerechtigkeitsfanatismus“, der vor allem bei den Grünen rund um die ehemalige Außenministerin Baerbock geherrscht habe. „Es ist naiv zu glauben, dass man den Bösen nicht einfach so davonkommen lassen dürfe und es deshalb vermeiden müsse, schmutzige Vergleiche zu schließen.“
Um sich aus dieser Eskalationsspirale zu befreien, fordert Müller statt der Stärke der Waffen das Prinzip der „Stärke der Güte“. So gebe es mehrere hundert Fälle, in denen Ukrainer gegen russische Soldaten erfolgreich gewaltfreien Widerstand geübt hätten. Friedliche Demonstrationen oder auch gemeinsames Singen habe eine wahnsinnig beruhigende, friedensfördernde Wirkung. Mit solchen Mitteln hätten etwa die Bewohner der ukrainischen Stadt Slawuta Massaker und Vergewaltigungen durch die russischen Besatzer verhindert.
„Aber Herr Müller“, fährt Neitzel hier dazwischen, „ich singe ja auch gern, aber das halte ich für zynisch. Da sind wir meilenweit auseinander. Die russische Armee hat eine extreme Gewalt-Disposition und dann den Ukrainern zu empfehlen, Leute, singt mal schön, ist extrem zynisch.“ Müller versteht den Punkt, gesteht ein, dass das Beispiel Slawuta aus der Anfangsphase des Kriegs stamme und stimmt zu, dass sich die russische Armee mittlerweile „barbarisiert“ habe.
Sein Leben für das Land opfern
Bleibt noch die im weiten Raum der einstigen Leichenhalle stehende Frage: Ist es als Staat moralisch vertretbar, vom Einzelnen zu verlangen, dass er für sein Land stirbt?
Neitzel wie aus der Pistole geschossen: „Ja. Nächste Frage.“ Für ihn selbst war der Wehrdienst zwar keine heroische Zeit, aber er wäre bereit, sein Leben für dieses Land zu opfern. Zudem könne das massive Personalproblem der Bundeswehr nur mit einer neuen Wehrpflicht gelöst werden.
Auch Müller ist für die Wehrpflicht, möchte jedoch eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Dienst an der Waffe oder alternativ eine Art Grundausbildung im gewaltfreien Widerstand. Als Beispiel für einen solchen nennt er Flashmob-Aktionen, die Schaffung von Parallelstrukturen im Untergrund oder auch Aktionen wie die des berühmt gewordenen „Tank Man“ vom Platz des himmlischen Friedens in Peking.
Dass es auch junge Ukrainer gebe, die nicht kämpfen möchten und daher nach Deutschland fliehen, findet er legitim und einen Akt der Humanität. „Die jungen Männer aus der Ukraine haben alles Recht der Welt, Angsthasen zu sein und wegzurennen.“ Neitzel nickt und merkt nachdenklich an: „Es ist ein Dilemma, das man schwer auflösen kann.“
„Philo.live!“ findet vom 14. bis 16. November im „silent green Kulturquartier“ in Berlin statt.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.