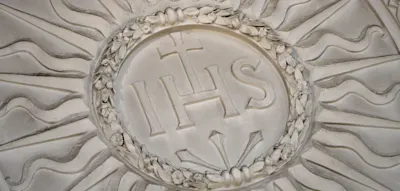Auf der gemeinsamen Liste der Kommunistischen Partei Österreichs, der KPÖ, und dem Bündnis Links für die Bezirksratswahlen in Wien fand sich im Frühjahr eine Kandidatin namens Julia Franz Richter. Nun gibt es Tausende Julia Richters. Aber wahrscheinlich nur eine mit dem Mittelnamen Franz, und tatsächlich, als Beruf gibt die Liste „Schauspielerin“ an. Ja, das ist sie, eines der vielversprechendsten neuen Gesichter des deutschsprachigen Films und Theaters, jene Julia Franz Richter, die im Februar gleich drei Filme auf der Berlinale hatte, von denen der interessanteste, „Welcome Home Baby“, nun in die Kinos kommt.
Nun ist die KPÖ, anders als die nach der Wiedervereinigung zusammengebrochene DKP, in Österreich durchaus ein Faktor. In Graz stellt sie die Bürgermeisterin und in Salzburg, jenem barock-konservativen Idyll, wurde ein Kommunist Vizebürgermeister. Und die Links-Bewegung trägt nicht die Altlast der früheren Diktatur wie die deutsche Linke, sondern ist eine Neugründung von 2020 und möchte für Antikapitalismus, Antirassismus, Feminismus und Solidarität stehen.
Mit 17 wollte Julia Franz Richter Soziale Arbeit studieren, wurde aber abgelehnt – zu wenig Erfahrung. Die hat sie sich als Kellnerin im Weberknecht-Keller geholt, einem der angesagtesten Clubs in Wien, und beim Suppenausschenken im Canisibus der Wiener Caritas. Sie hat Schauspiel in Graz studiert und gemerkt, dass Darstellungsformen und Arbeitsbedingungen oft noch tief im vorigen Jahrhundert stecken. Sie aber glaubt an Kunst als transformative Kraft und dass ein Akt des Widerstands häufig etwas Performatives habe.
Jedoch, um etwas zu verändern, schreibt sie auf ihrer Links-Webseite, müsse man auch aus den Institutionen heraus. Im Lockdown habe sie gelesen, dass es diese neue queerfeministische Partei gebe. Und über Autorinnen wie die amerikanische Philosophin und Aktivistin Silvia Federici sei sie dann bei Marx gelandet: „Die kapitalistische Akkumulation hat mir eine Freundin betrunken auf dem Balkon erklärt. Sie hat das Kapital aufgeschlagen wie eine Bibel.“
Damals hatte der Film Richter schon entdeckt, blonde Locken, helle Stimme, raues Lachen, große Ernsthaftigkeit. Der österreichische Film ist nicht wie der deutsche. Er war schon immer sozialrealistischer, schwarzhumoriger, düsterer, selbst in seinen Mainstream-Ausprägungen. Und er ist seit einiger Zeit dabei, amerikanische Genremuster ins Österreichische zu übersetzen: Horror, Western, Science Fiction.
„Rubikon“, Richters erste große Hauptrolle, erscheint wie ein Widerspruch in sich selbst: ein österreichischer Science-Fiction-Film! Aber das hat seine Richtigkeit, handelt Magdalena Lauritschs Debüt doch von dieser österreichischen Spezialität, dem Tod, dem Weltuntergang. Julia Richters Hannah befindet sich isoliert auf einem Raumschiff mit zwei Männern, die sie nicht kennt, und sie – von Beruf Soldatin – muss nun Entscheidungen selbst treffen, statt Anweisungen auszuführen.
Sie sieht, wie eine Umweltkatastrophe die Erde zerstört und die Unterschiede zwischen den Klassen zuspitzt, weil niemand daran denkt, solidarisch zu sein und umzuverteilen. Am Ende besitzen sehr wenige Menschen sehr viel und sehr viele gar nichts. Hannah gehört nicht zu den Privilegierten und begreift plötzlich, was das für ihr Leben bedeutet. Man sollte vielleicht erwähnen, dass Julia Richter auch Mitglied in dem Künstlerkollektiv Franz Pop Collective ist und in einem Lied „Don’t worry, it’s gonna get worse … People wanting things to go back, it’s not gonna work“ singt.
Leute, die sich die Vergangenheit zurückwünschen, sind auch der Kern von Andreas Prochaskas „Welcome Home Baby“. Julia Richters Judith führt darin in Berlin ein kontrolliertes, gleichberechtigtes, autonomes Leben. Als ihr Vater stirbt, will sie die Erbschaftsangelegenheiten in der österreichischen Provinz möglichst schnell erledigen.
Im väterlichen Haus wird sie von Frauen aus dem Dorf fürsorglich umhegt; man könnte es auch „besitzergreifend“ nennen. Judith erlebt zunehmenden Kontrollverlust. Aus Freundlichkeit wird Brutalität, denn die dörfliche Gemeinschaft braucht Nachwuchs. Die Frauen, die dort das Regiment führen, erinnern an die kochenden, putzenden, gebärenden Mafia-Frauen, die das System Generation auf Generation erhalten.
„Welcome Home Baby“ erzählt nicht von einem Matriarchat, wohl aber davon, wie viel Druck immer wieder von Frauen auf Frauen ausgeübt wird. „In rechten Kreisen wird das ja auch von Frauen ausgeführt“, sagt Richter im Interview. „Ich will gar keine Namen nennen …“ – „Eine heißt Alice.“ – „Ja, eine heißt Alice“, sagt Richter und lacht laut auf.
„Welcome Home Baby“ ist ein Horrorfilm, ist ein Psychothriller, es geht um die Selbstbestimmung von Frauen, und das nicht nur in Bezug auf das Leben, das sie führen, sondern sehr konkret auch auf ihren Körper. Julia Franz Richters Kinodebüt war „L’animale“ über einen Wildfang in einer Kleinstadt, die mit ihrer Geschlechtsidentität ringt; dessen Regisseurin heißt Katharina Mückstein – die mit einem Instagram-Posting für einen Aufschrei in der österreichischen Filmszene sorgte, weil sie Missbrauch in der Branche beim Namen nannte, von dem viele lange wussten, aber schwiegen.
Auch Richters Lieblingsfilm stammt von einer Frau, Franziska Pflaum, die Tragikomödie „Mermaids Don’t Cry“ über zwei Supermarktkassiererinnen im Wiener Arbeiterinnenmilieu, skurril wie Wes Andersons „Tiefseetaucher“ und lebensweltecht wie Thomas Stubers „In den Gängen“.
Richters Partnerin in „Mermaids“ war Stefanie Reinsperger, die mutigste aller österreichischen Schauspielerinnen (und das will etwas heißen, sind österreichische Schauspielerinnen doch generell um einiges furchtloser als die in Deutschland). Und wie Reinsperger, die den Sprung zum Berliner Ensemble machte, wagt sich Richter zunehmend über ihre Heimat hinaus: zwei Jahre am Münchner Volkstheater, mit dem Jandl-Stück „humanistää!“ an die Berliner Festspiele, mit dem Syrienemigranten-Film „Die Schattenjäger“ zur Eröffnung der Semaine de la Critique in Cannes.
In den Bezirksrat der multikulturellen Leopoldstadt im zweiten Wiener Gemeindebezirk hat Richter es nicht geschafft, dafür stand sie zu weit hinten auf dem Wahlvorschlag, aber immerhin erhielt sie dort die fünftmeisten Stimmen, und die gemeinsame KPÖ/Links-Liste stellt nun 49 Bezirksräte in allen 23 Wiener Bezirken.
Die 34-Jährige wird weiter Kunst machen, Film und Theater und Pop, in dem vollen Bewusstsein, dass sich diese Kunst nur noch ein immer kleiner werdender, immer privilegierterer Kreis von Menschen leisten kann. Es gibt genug zu tun für Richter, die Aktivistin. Der Anteil der rechtspopulistischen FPÖ bei den Bezirksvertretungswahlen hat sich nahezu verdreifacht.
P.S.: Der Name Franz ist Familientradition. Alle erstgeborenen Männer in der Familie trugen den Vornamen Franz, bei dem Mädchen Julia wurde ein Mittelname daraus. Was nur recht und billig ist, denkt man an Rainer Maria Rilke, Klaus Maria Brandauer und Carl Maria von Weber.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.