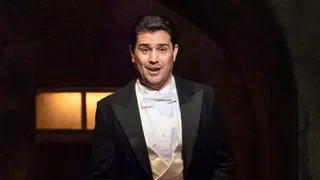Iris Berben trägt eine schwere Tasche mit sich. Der Tisch im Besprechungsraum von Moovie, der Berliner Filmproduktionsfirma ihres Sohnes Oliver, füllt sich mit Büchern und Zetteln. Sie hat richtig gearbeitet in ihrer großen Bibliothek. Bücher aus den Regalen genommen, die sie ihr Leben länger begleiten als das Filmen, mit dem sie begonnen hat, bevor sie mit der Schule fertig war. Beim Wiederlesen hat sie festgestellt, dass „man Bücher zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich liest und versteht und beurteilt“. Immer wieder ist sie, die eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen ist und Präsidentin der Deutschen Filmakademie war, mit Büchern unterwegs. Liest überall in Deutschland gegen das Vergessen der Geschichte, stellt auf Lesungen die Gedichte der Selma Meerbaum-Eisinger vor und Literatur von Holocaust-Überlebenden. Beim Friedrich-Engels-Gymnasium in Senftenberg engagiert sie sich für das Buchprojekt „Für Demokratie Gegen Extremismus“.
Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter
Das ist das Buch, an das ich mich aus meiner Kindheit am liebsten erinnere. Als ich die Geschichten jetzt wieder gelesen habe, dachte ich mir allerdings, dass es gar kein Kinderbuch ist, sondern eins für Erwachsene, eins darüber, wie man es nicht machen sollte in der Kindererziehung. Als Kind fand ich es aufregend, spannend. Meine Lieblingsgeschichte ist – bis heute übrigens – die vom Zappelphilipp. Das war auch meine erste Theaterrolle im Kindergarten. Heute würde man sagen, dass man sich beim Casting nicht sehr viel Mühe gemacht hat. Ich war auf den Punkt besetzt. Einen Satz habe ich noch in Erinnerung, den die Erwachsenen und vor allem meine Mutter oft zu mir gesagt haben: Kannst du mal still sitzen? Mein Partner sagt das heute noch.
Ich weiß natürlich, dass manche Probleme haben mit dem Buch. Man würde den „Struwwelpeter“ heute anders schreiben. Aber Texte zu eliminieren aus dem Buch, halte ich für falsch. Ich denke, es ist ein Dokument dafür, was war und wo wir herkommen, wie sich die Zeiten verändert haben. Und als Aufforderung zu erklären, warum das heute so nicht mehr geht, was da steht. Und manchmal kippt man dann ja auch das Kind mit dem Bade aus.
Die Geschichte vom schwarzen Buben zum Beispiel ist, obwohl das Wort Mohr vorkommt, im Kern natürlich eine Geschichte gegen Ausgrenzung und Rassismus. Der „Struwwelpeter“ wird für mich immer Kindheit bedeuten.
Françoise Sagan: Bonjour Tristesse
Die Zeitschrift „Brigitte“ hatte 2006 eine Hörbuchedition aufgelegt. „Starke Stimmen“. Ich hatte vorgeschlagen, Françoise Sagans „Bonjour tristesse“ zu lesen. Das kennen schließlich nur noch wenige, gerade unter den jungen Leuten. Das kam auch ganz gut an, bis sich herausstellte, dass der Roman gar nicht mehr aufgelegt wurde. Das sei doch ein besonderer Grund, es gerade jetzt zu machen, meinte ich. Das Hörbuch wurde über 100.000 Mal verkauft. Die erste und einzige Goldene Schallplatte, die ich je bekommen habe. Hängt bei mir zu Hause.
Der Roman spiegelt ein Lebensgefühl, eine Leichtigkeit, das Flirrende, für das die Franzosen in den 1960ern standen, eigentlich immer noch stehen. Die Sehnsucht nach diesem Flirren ist mir bis heute geblieben und ich mag Sagans Sprache. Die kann man fühlen, schmecken, die kann man riechen. Sie war dieses ungezogene, ungehorsame freie Mädchen, was ich extrem feministisch fand. Sie hatte keine Angst vor nichts. Worüber sie geschrieben hat, war damals total unmoralisch. Sexualität durfte ja nicht benannt werden. Das war der Moment, in dem ich zum Leben erwacht bin. „Bonjour Tristesse“ ist auch ein zeitloses Buch. Es beschreibt Sehnsucht, und die verändert sich nicht. Die Sehnsucht bleibt. Schön eigentlich.
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Das Buch war der schmerzhafte Abschied von einer Überzeugung, der Idee eines wirklich gerechteren Lebens, von der Möglichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenlebens im Zeichen von Gerechtigkeit und Gleichheit. Wir alle kennen ja diesen Satz: Wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 noch ist, hat keinen Verstand. Gleichheit, Gerechtigkeit – das waren Ideale auch meiner Jugend, in den 1960er-Jahren.
Ich will mir die Idee immer noch nicht zerstören lassen. Den wahrscheinlich naiven Traum, dass es eine Möglichkeit gibt, gerecht miteinander leben zu können, ohne Machtmissbrauch, ohne Unterdrückung in Freiheit für alle. Dann las ich Koestlers Buch – und was der Stalinismus aus diesen Idealen gemacht hat. Mir sind die Tränen gekommen. Diese Demütigungen, Brutalität, Verachtung, diese Härte, mit der Stalins System mit den Menschen umgegangen ist.
Einem System, dem es nur um Macht und Unterdrückung ging und nicht um die Menschen. „Sonnenfinsternis“ schaffte es, eine Idee und ein Ideal für mich infrage zu stellen, vieles, was ich mit großer Naivität einmal eingefordert hatte. Ein toller Satz steht in Koestlers Buch – er stammt von Bertrand Russell: Das Ärgerliche in dieser Welt ist, dass die Dummen todsicher und die Intelligenten voller Zweifel sind.
Leo Tolstoi: Anna Karenina
Vor gut anderthalb Jahren wurde ich gebeten, für einen Kanon der 100 besten Bücher, etwas über Tolstois „Anna Karenina“ zu schreiben. Und obwohl ich eigentlich nur noch mal reinschauen wollte, las ich am Ende alle 1227 Seiten. Ich war wie in einem Rausch.
Zum ersten Mal bin ich „Anna Karenina“ begegnet, da war ich etwa 24 Jahre alt, alleinerziehend mit einem dreijährigen Kind. Und ich sah mich damals in der Anna Karenina, in der Suche nach einem Platz im Leben, nach Liebe, Gefühlen. Jetzt habe ich es mit einer großen Lust wieder gelesen, weil Tolstois Welt nicht weit entfernt ist von der unsrigen.
Er erzählt von so vielem, mit dem wir uns heute genauso beschäftigen: den Spielarten der Liebe, dem Sinn des Lebens, dem Sinn des Lebens nach dem Tod. „Anna Karenina“ verhandelt Religion, Gott, Macht, eine Gesellschaft, die in ihren Komfortzonen verharrt, eine Regierung im Krieg, Bildung für das Volk, Frauenrechte, Ausbeutung, Arbeiter – eine unendlich komplexe Welt, die ich – wie die Figuren neben Anna – gar nicht gesehen hatte beim ersten Lesen.
Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe
Meine Mutter gab mir das Buch zu lesen. Sie hat in Portugal gelebt. Eine Frau, die man nie ohne ein Buch in der Hand angetroffen hat. Es waren auch immer Bücher, über die wir uns ausgetauscht haben.
Pessoa ist so analytisch mit sich und mit dem Leben umgegangen. Das kommt mir nahe. Es hat eine tiefe Melancholie und eine tiefe Sehnsucht, dieses Buch. Das ist ja auch typisch portugiesisch. Nicht umsonst gibt es dieses schöne Wort, was man nicht übersetzen kann: Saudade, ewige Sehnsucht nach etwas, was man nicht benennen kann. Es ist ein Buch des Beobachtens, des Wahrnehmens, Belauschens.
Ich blätter häufig drin herum. Es trainiert mein Gucken und mein Hören. Ich bin schon auch jemand, der offenen Auges und offenen Ohres durch die Welt geht. Aber es macht wirklich Spaß, mit Pessoas Sinnen sich dem Alltag auszusetzen. Wenn es nicht so ein schweres Buch wäre, müsste man es ständig dabeihaben. Eine Geschichte erzählt Pessoa nicht. Das ist aber auch das Besondere. Meine Mutter hat mir schon gesagt, als ich anfing zu lesen, dass es mühsam wäre, dranzubleiben: Aber schlag es irgendwo auf. Pessoa nimmt dich mit. Du bist sofort bei ihm. Das schaffen wirklich nur die Meister.
David Grossman: Kommt ein Pferd in die Bar
David Grossman, der israelische Aktivist und Schriftsteller, und seine Bücher ziehen sich durch mein Leben wie eine Perlenkette. Es begann mit seinen politischen Essays in „Die Kraft zur Korrektur“, dann „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“, der schmerzhafte „Brief am Grab meines Sohnes“. 2018 sind wir uns in Potsdam das erste Mal begegnet und hatten ein Podiumsgespräch über „Kommt ein Pferd in die Bar“.
Dieses Buch ist anders als alle anderen Bücher, die ich von ihm gelesen habe. Es ist sprachlich anders – und inhaltlich: Ein Comedian, der auf den ersten Blick eher unsympathisch ist, laut, zynisch, konfrontiert auf der Bühne das Publikum plötzlich mit seiner Familiengeschichte und den Traumata des Holocaust. Dabei verletzt er nicht nur das Publikum, er verletzt sich die ganze Zeit auch selbst. Grossman zeigt – wie auch Amos Oz, mit dem ich zu Lesungen in ganz Deutschland unterwegs war, wie der Auschwitz-Überlebende József Debreczeni, dessen Buch „Kaltes Krematorium“ ich gerade vorstellen durfte, wie die Niederländerin Chaja Polak – auf welch unterschiedliche Weise man von dieser Zeit erzählen kann.
Welche Kraft Sprache, Literatur hat, den Schmerz zu transportieren, wachzuhalten. Trotzdem Trost zu spenden, uns nicht allein zu lassen. Deswegen wird es zwischen der Literatur und mir immer eine ganz, ganz tiefe Bindung geben.
W. Timothy Gallwey: Tennis, das innere Spiel
Das Buch liegt immer dann in Reichweite, wenn ich mit den Vorbereitungen zu einem neuen Film beginne. Wenn meine Verunsicherung, meine Selbstzweifel, meine Minderwertigkeitskomplexe wieder da sind und mir zuflüstern: Kannst du das, bist du die Richtige? Ganz viel meiner Arbeit hat mit Konzentration zu tun und bei mir auch mit Nervosität. Gallwey ist ein wichtiger Coach, nicht nur in den USA und nicht nur für Tennis.
Er sagt – was nicht nur fürs Tennis gilt, sondern auch für meinen Beruf, für eigentlich jede Lebenslage –, dass es ein inneres und ein äußeres Spiel gibt. Das eine ist der Bestimmer, das andere ist der Macher. Und die muss man zusammenbringen. Zwischen Grübeln und Tun muss man die Waage halten lernen. Der eigene Anspruch und die ewige Selbstreflexion, da habe ich mich doch sehr wiedergefunden, stehen dieser Balance gern im Weg.
Und Gallwey erklärt auf eine sehr kluge Weise, wie man damit umgeht, mit der Angst vor allem, wie man Ängste wahrnimmt und Genuss findet an dem, was vor einem liegt. Man soll das Selbstzweifeln ja nicht lassen, aber überhandnehmen darf es eben auch nicht.
Kressmann Taylor: Adressat unbekannt
Ich mache viele Lesungen gegen das Vergessen unserer Geschichte, gegen Antisemitismus, habe Anne Frank und Joseph Goebbels’ Tagebuch-Eintragungen einander gegenübergestellt, mich intensiv und immer wieder mit Literatur über Nationalsozialismus und Holocaust beschäftigt. Und dann ist mir Kressmann Taylors Büchlein in die Hand gefallen. „Adressat unbekannt“ ist so erschreckend, weil es so furchtbar aktuell ist. Erschienen ist es 1938 in den USA und hat dort ungeheures Aufsehen erregt, weil es schon damals so klar in die Zukunft geschaut hat. Auf ganzen 60 Seiten in Form von Briefen zeigt es den schleichenden, erschreckenden Weg zum Nationalsozialismus hin.
Zwei Freunde, die sich schreiben. Der eine – Martin Schulse – ist Deutscher, der andere – Max Eisenstein – ist Jude. Sie haben eine gemeinsame Kunstgalerie und sind Geschäftspartner. Max bleibt in Amerika und Martin fährt zurück nach Deutschland. Die Briefe sind Dokumente einer Entzweiung, einer Entfremdung zwischen Max und Martin, dessen Denken sich immer antisemitischer radikalisiert. Die Dramatik in diesem Buch kann man fast körperlich spüren. Das nimmt einem den Atem.
Edgar Hilsenrath: Der Nazi und der Friseur
Auf dieses Buch hat mich ein sehr guter Freund, der viel zu früh verstorbene Regisseur Peter Patzak aufmerksam gemacht. Der hatte einen außergewöhnlichen Blick auf Stoffe. „Der Nazi und der Friseur“ erzählt sehr grotesk von Nationalsozialismus und Shoah, aus Sicht eines Täters, was ja eher selten vorkam. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und Patzak wollte das verfilmen.
Anfang der 1990er haben wir uns mit Hilsenrath in der Berliner Paris Bar getroffen, eine ganz spannende Begegnung für mich, weil dieser Mann eine besondere Biografie hatte. Geboren in Leipzig, dann nach Rumänien, dort ins Getto deportiert, später war er in Palästina, danach New York, und von New York ist er dann zurück nach Berlin und hier gestorben.
Es gab ein Drehbuch und eine Rolle für mich, die ich unbedingt spielen wollte. Der Film ist aber nie gedreht worden, weil die Rechte in Amerika lagen. Schade, weil es wirklich ein großer Wurf war. Weil Hilsenrath sehr skurril, ohne die übliche Zeigefingerei, aber mit viel Humor und latenter Tragik, Menschen an ein vermeintlich erdenschweres Thema heranführen kann.
Marguerite Duras: C’est tout
Das ist das Buch, das seit Erscheinen immer in meiner Nähe liegt. Marguerite Duras ist mir so vertraut. Von ihr habe ich zum ersten Mal Ende der 1960er-Jahre gehört. Eine politische Frau, eine laute. Und – im Gegensatz zu mir – ihr Leben lang Kommunistin.
Marguerite Duras war für mich eine der ersten Feministinnen, deren Bücher ich gelesen habe. „C’est tout“ sind gewissermaßen ihre letzten Worte. Sie denkt – in Notizen, Dialogszenen, Fragmenten – noch einmal über das Leben nach, spricht vom Ende. Und über alles, worüber sie immer schon geschrieben hat – über Schmerz und Tod, Liebe, Begehren und über die Angst.
Ich mag ihren Schreibstil, weil er sehr klar, sehr radikal ist, nie ein Wort zu viel. Und immer ist in der Kürze auch eine große Härte. Außerdem liegt mir ihre Lakonie sehr. Das scheint etwas Französisches zu sein – lakonisch mit dem Leben umzugehen. In „C’est tout“ sagt sie zum Beispiel: „Es ist aus. Das ist der Tod. Es ist grauenhaft. Es ist mir lästig zu sterben.“ Marguerite Duras ist angstfrei gewesen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.