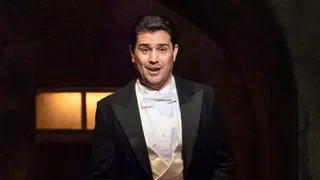„Ich fürchte, der brennt nicht einmal.“ Kurz darauf: „Ich weiß nicht, welcher Architekt den Bungalow gebaut hat. Aber er verdient zehn Jahre.“ Mit diesen Worten von Konrad Adenauer zum Bonner Kanzlerbungalow beginnt die Dokumentation „SEP RUF – Architekt der Moderne“ von Johann Betz.
Derlei Zitate mögen in der Rückschau reaktionär wirken, und doch illustrieren sie knapp und treffsicher den Diskurs der damaligen Zeit: Hier die Traditionalisten, die mit diesem Solitär der architektonischen Moderne nur wenig anfangen konnten, die sich Repräsentanz im tradierten Trutzburgstil wünschten. Sie stellten in der Kanzlerschaft der Bonner Republik die Mehrheit; selbst Helmut Kohl ließ in den 1980er-Jahren noch Änderungen an dem Gebäude durchführen, um es seinen Vorstellungen von Behaglichkeit anzupassen.
Und dort die Visionäre und ihr Gedanke, ein neues Deutschland brauche auch eine neue Art des Bauens, eine, die nicht hierarchisch denkt, sondern ganz und gar auf Austausch setzt; Ludwig Erhard, der den Kanzlerbungalow 1963 noch als Wirtschaftsminister in Auftrag gegeben hatte, gehörte zu ihnen. Den Baumeister Sep Ruf kannte er bereits: Dieser hatte einige Jahre zuvor sein Wohnhaus in Gmund am Tegernsee entworfen.
Ruf (1908–1982) zählt zu den prägenden Figuren der deutschen Nachkriegsarchitektur – und blieb doch lange unterschätzt. Aufgewachsen in München, ausgebildet an der Technischen Universität seiner Heimatstadt, gehörte er ab 1945 zu jenen Architekten, die sich der Aufgabe stellten, dem zerstörten Land ein neues, demokratisches Gesicht zu geben. Dabei stand niemals die große Geste im Vordergrund, sondern eher eine Architektur des Understatements – funktional, menschenfreundlich, bisweilen heiter.
Ruf selbst verwendete gerne einen Begriff, den wir aus der Musiktheorie kennen: „Wohltemperiert“ sollte alles sein, was er baute. Wer heute an der Münchner Maxburg vorbeiflaniert, an Rufs Bungalow im Berliner Hansaviertel, am ehemaligen Staatsbankgebäude in Nürnberg, in dem heute das bayerische Heimatministerium zu Hause ist, oder an seinen Bauten am Tegernsee, wird rasch erkennen, mit welchen Kniffen er das erreichte: filigrane Stahlstützen, großzügige Glasflächen, flache Dächer und immer wieder Rückgriffe auf traditionelle Baustoffe und -formen ergeben eine fast schwebende Eleganz, die in der deutschen Architektur der Moderne nur wenige Vergleiche zulässt.
Vielleicht erlaubt sich der Film deswegen den Luxus, sehr nah an seinem Protagonisten zu bleiben. Andere Architekten der Zeit werden kaum erwähnt oder gezeigt, lediglich Egon Eiermann, mit dem Ruf auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel den Deutschen Pavillon baute, wird länger behandelt. Stattdessen ordnen verschiedene Stimmen in einer Art Oral History, die sich an einigen von Rufs wichtigsten Bauten entlangzieht, dessen Laufbahn ein. Studenten von der Nürnberger Akademie der Künste kommen dabei ebenso zu Wort wie Familienmitglieder, die heutigen Bewohner seiner Häuser sind zu hören, Architekten und ehemalige Schüler. So entsteht ein steter, von Prachtbildern begleiteter Flow, bei dem freilich eine Frage offen bleibt: Soll Sep Ruf als Architekt im Zentrum stehen – oder als Mensch, leise auftretend, gleichzeitig aber chic, oft im weißen Anzug und mit einer Vorliebe für schnelle Autos?
Hier entzieht sich der Film einer allzu genauen Antwort. Eher tastet er sich eineinhalb Stunden lang mit langsamen Kamerafahrten und beschwingten, an die 1950er-Jahre erinnernden Tönen zwischen Easy Listening und Jazz an Ruf heran. Dabei sind die Szenen am stärksten, in denen Betz einige Schritte wegtritt von der akademischen Schilderung von Rufs ja hinreichend dokumentierten Bauten. Dann erfährt man von fluchenden Arbeitern, die bei der Sanierung des Ruf-Hauses in der Münchner Theresienstraße ihre liebe Not damit hatten, in die Metallstützen zu bohren – irgendwann stellten sie fest, dass diese aus alten Geschützrohren bestanden. Erzählt wird aber auch von „der Lutherin“, Sekretärin Rufs und so etwas wie der Majordomus seines Büros, sowie Rufs Liebe zu Italien.
Die Befragten meiden zwar jede Überhöhung, bleiben aber stets wohlwollend, von Adenauers Eingangszitat abgesehen werden die Kritiken, denen sich Ruf und seine Bauten durchaus ausgesetzt sahen, nur am Rande thematisiert. „Im Winter leiden wir immer ein bisschen“, erklärt einmal Holger Felten, Präsident der Nürnberger Akademie der Künste, man säße, so fügt eine seiner Studentinnen an, dann in dicken Jacken in den Klassenzimmern. Ein Blick in die Archive ist da durchaus erhellend: Bereits 1961 berichtete die „Zeit“ von Baumängeln an der Akademie – „fehlerhafte Dacheindeckung, unzureichende Lüftung und zu niedrige Arbeitsräume“ wurden ihm damals zur Last gelegt. Auch bei der Maxburg, so hieß es weiter, gebe es „alljährlich zwischen 20.000 und 30.000 Mark an Reparaturen“, aus „ziemlich denselben Gründen“ – eine schöne Parallele zur Gegenwart, in der zahlreiche Bauprojekte von ähnlichem Grundrauschen begleitet werden.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.