- Neue Datenblätter für Personen mit geänderten Einträgen.
- Vertretungen der Betroffenen kritisieren das Vorhaben einhellig.
- Auch Professorin für Recht der Digitalisierung zweifelt am Sinn.
- Kritik auch von der Linken – Haltung der SPD vorerst offen.
Bei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt geplante Änderungen im Meldewesen sorgen in der queeren Community für Unruhe. Der Vorwurf: Die Verordnung zur Umsetzung des noch jungen Selbstbestimmungsgesetzes könnte dessen Ziel – unbürokratische und diskriminierungsfreie Änderungen von Geschlechtseinträgen und Vornamen – in der Praxis konterkarieren.
Erst im November 2024 war das SBGG der Ampel-Koalition aus SPD, den Grünen und FDP in Kraft getreten, um Änderungen von Geschlechtseinträgen und Vornamen in Personenstandsregistern weiter zu erleichtern.
Ein wichtiger Punkt des SBGG war auch das Offenbarungsverbot. Es soll Menschen mit geänderten Einträgen vor unnötigen unfreiwilligen "Outings" schützen. Das jedoch sehen der Bundesverband Trans* e.V., die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit, der LSVD⁺ Verband Queere Vielfalt und der Paritätische Gesamtverband jetzt in Gefahr.
Der Referentenentwurf von Mitte Juli
Der Grund: Ein Verordnungsentwurf des Bundesinnenministeriums von CSU-Politiker Alexander Dobrindt sieht vor, in die Datensätze im Meldewesen neue Daten aufzunehmen – den Geschlechtseintrag und Vornamen vor ihrer Änderung, deren Datum, die ändernde Behörde und das Aktenzeichen.
Sinn ist laut Entwurf, diese Angaben durch Meldebehörden etwa auch an Rentenversicherung oder das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln zu können. Das Ministerium begründet das vor allem mit einem Bedürfnis nach Nachverfolgbarkeit. Eine persönliche Identität soll demnach in behördlichen Registern und Systemen nach Änderungen nachvollziehbar bleiben.
Ein Sprecher des Ministeriums sagte MDR AKTUELL, diese Verordnung sei "technisch" nötig, um das sichere Handeln von Behörden zu ermöglichen. Auch sei Nachvollziehbarkeit im SBGG mit angelegt gewesen. Der Entwurf war demnach länger in Arbeit; und dass er erst jetzt öffentlich geworden sei, habe an Abstimmungen mit Ländern, Ämtern und IT-Dienstleistern gelegen.
Viel Kritik von den Verbänden
Vertretungen von Betroffenen bezweifeln allerdings einhellig, dass die geplanten Änderungen für die angebenen Zwecke wirklich nötig sind. In ihren auf der Seite des Innenministeriums nachlesbaren Stellungnahmen warnen sie vor unnötigen Einschränkungen von Grund- und anderen Rechten.
Diesen Stellungnahmen zufolge fürchten die Verbände, dass trans, nicht-binäre und intergeschlechtliche Personen als solche immer wieder bekannt gemacht werden, was sie einem erhöhten Diskriminierungsrisiko aussetze. Sie argumentieren, dass das Offenbarungsverbot im SBGG vorsehe, alte Namen und Geschlechtseinträge nur in wichtigen Ausnahmen zu offenbaren.
Bei den Dobrindt-Plänen jetzt sei aber völlig unklar, wozu das Zentralamt für Steuern etwa oder die Deutsche Rentenversicherung die neuen Datenblätter zum früheren Geschlechtseintrag überhaupt bräuchten, hieß es.
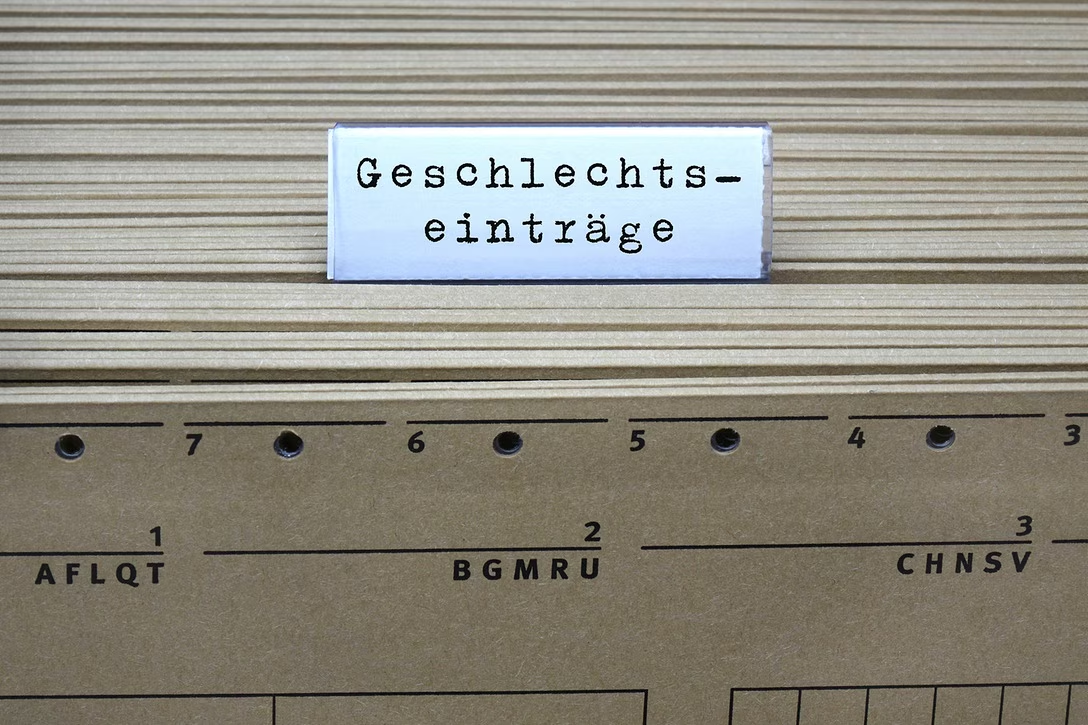 Offenkundig herrscht Unklarheit über den behördlichen Bedarf an sensiblen Informationen.Bildrechte: IMAGO/Steinach
Offenkundig herrscht Unklarheit über den behördlichen Bedarf an sensiblen Informationen.Bildrechte: IMAGO/SteinachDie Rentenversicherung werde über eine Änderung der Sozialversicherungsnummer informiert, eine Steuer-Identifikationsnummer aber ändere sich nie. Und über frühere Einträge von Geschlecht und Vornamen müsse weder die Steuer- noch eine Meldebehörde bei einem Zuzug automatisch informiert sein.
Auch, so führen die Verbände an, seien Identitäten einer Person etwa über das Bundeszentralregister nachvollziehbar, auf das auch Sicherheitsbehörden – bei Bedarf – Zugriff haben. Eine weitere Möglichkeit sei auch § 45 Personenstandsgesetz. Worin also die grundsätzliche Neuerung des Selbstbestimmungsgesetzes gegenüber der bisherigen Rechtslage besteht, die "eine Ausweitung der Datenübermittlung" nun erforderlich mache, werde hier nicht ausreichend begründet.
Dass den Sachbearbeitenden in den Behörden klar wird: Die Person, mit der ich es zu tun habe, ist trans oder inter oder nicht binär, jedenfalls nicht normal.
Jonas Leutz vom Lesben- und Schwulenverband in Sachsen-Anhalt (LSVD) äußerte sich "perplex". Er sagte MDR AKTUELL, das Ziel sei wohl, "dass den Sachbearbeitenden in den Behörden klar wird: Die Person, mit der ich es zu tun habe, ist trans oder inter oder nicht binär, jedenfalls nicht normal."
Die meiste Diskriminierung kommt aus dem öffentlichen Sektor.
Silvia Rentzsch vom Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V. sagte MDR AKTUELL: "Die meiste Diskriminierung kommt aus dem öffentlichen Sektor", also auch von Behörden, was damit jetzt noch befördert werden könne.
Gemeinsam fürchten die Verbände, dass "durch diese Initiative des Bundesgesetzgebers eine Ausweitung der Weitergabe der Datenfelder erfolgen" solle, was etwa auch der Paritätische Gesamtverband als "nicht verhältnismäßig" zurückweist. Gefordert werden eine gründliche Prüfung und die Klärung bestimmter Fragen; gesetzlich und nicht nur per Verordnung.
Auch Expertin bezweifelt Sinn des Vorhabens
Dem würde sich auch Indra Spiecker anschließen, Professorin für Recht der Digitalisierung und Leiterin des Instituts für Digitalisierung an der Universität Köln. "Tendenziell leuchtet mir nicht ein, warum das nötig sein sollte", sagte sie MDR AKTUELL am Telefon zu den geplanten neuen Datensätze. Und für spezielle Fälle seien auch hier einzelne gesetzliche Regelungen sicherer. Denn je dezentraler dergleichen geregelt werde, um so mehr Schutz gebe es.
Kritik der Linken – Haltung der SPD noch offen
Anders als SPD-Kollege Falko Droßmann kritisierte die Pläne auch Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Er warnte vor einem "staatlich automatisierten Zwangs-Outing von trans Personen im Kontakt mit Behörden", die "ein höheres Diskriminierungsrisiko haben".
 Maik Brückner (zweiter von links) bei einer Aktion "Für queere Sichtbarkeit am Bundestag"Bildrechte: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Maik Brückner (zweiter von links) bei einer Aktion "Für queere Sichtbarkeit am Bundestag"Bildrechte: picture alliance/dpa | Soeren StacheAuch Brückner sagte MDR AKTUELL, das neue Selbstbestimmungsgesetz führe in "keine erkennbar veränderte Sachlage, die eine solche drastische Ausweitung der Datenspeicherung rechtfertigen würde".
Herr Dobrindt und die Koalition müssen sich fragen, ob sie da mitschwimmen wollen.
Man müsse hier auch verhindern, "dass Daten von trans Personen missbräuchlich zu digitalen 'Listen' gebündelt werden und in die falschen Hände geraten", meinte Brückner. Denn es gebe einen "gefährlichen Trend zu transfeindlichen Gesetzen", wie in Ungarn und den USA und: "Herr Dobrindt und die Koalition müssen sich fragen, ob sie da mitschwimmen wollen."
 Ob sich Justizministerin Stefanie Hubig noch in den Streit einschaltet, war offen.Bildrechte: picture alliance/dpa | Britta Pedersen
Ob sich Justizministerin Stefanie Hubig noch in den Streit einschaltet, war offen.Bildrechte: picture alliance/dpa | Britta PedersenNach dem Sinn dieser Verordnung "werden wir den Innenminister im Parlament fragen", sagte Brückner. Doch ob Dobrindt dazu im Bundestag überhaupt Stellung nehmen muss, ist fraglich. Sein Sprecher erklärte dazu am Telefon, dass auch keine anderen Bundesministerien an dem Vorgang beteiligt werden und allein die Länder im Bundesrat noch zustimmen müssten.
Das CDU-geführte Bundesfamilienministerium, in dessen Zuständigkeit das SBGG liegt, verwies auf MDR-Anfrage auf das Dobrindt-Ministerium, hält sich da also raus. Auch das von der SPD-Politikerin Stefanie Hubig geführte Bundesjustizministerium wollte sich auf Anfrage nicht näher zur Sache einlassen. Es sei jedoch in eine Ressortabstimmung eingebunden, die sei aber noch nicht abgeschlossen.
MDR AKTUELL
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.



