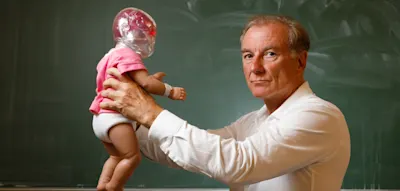Das Video, das ein Informant der WELT aus der sudanesischen Stadt Al-Faschir geschickt hat, ist erschreckend. Sieben Männer sitzen auf dem Boden, offenbar hatten sie aufseiten der Armee gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) gekämpft. Jetzt sind sie in Gefangenschaft geraten, weil die Miliz am Wochenende die Stadt erobern konnte. „Sind Zivilisten unter euch?“, ruft eine Stimme. Die Männer verneinen. Dann sollen sie offenbar an einen anderen Ort gehen. Die Männer greifen nach ihren Wasserkanistern, stehen auf – kurz darauf werden sie von hinten erschossen. In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche ähnliche Videos, deren Authentizität sich nicht immer prüfen lässt, deren Darstellungen jedoch mit Berichten Geflohener übereinstimmen.
Nach Angaben sudanesischer Ärzteorganisationen wurden in den vergangenen Tagen in Al-Faschir nicht nur Kämpfer, sondern auch zahlreiche Zivilisten getötet. Krankenhäuser und Apotheken, die bis zuletzt versuchten, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten, seien geplündert worden. Menschenrechtsgruppen berichten zudem von mehr als 1000 Festnahmen. UN-Vertreter sprachen von „sehr glaubwürdigen Hinweisen auf Kriegsverbrechen“.
In Al-Faschir lebten zuletzt rund 260.000 Menschen in akuter Not – etwa die Hälfte von ihnen Kinder. Sie saßen in der belagerten Stadt fest, ohne Wasser, Nahrung oder medizinische Versorgung. Der Leiter des UN-Nothilfebüros, Tom Fletcher, forderte „sicheren, schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“, um der in der Stadt verbliebenen Bevölkerung zu helfen.
Mit ihrer am Sonntag vermeldeten Einnahme von Al-Faschir kontrolliert die RSF nun nahezu vollständig Darfur im Westen des Landes, ein Gebiet ungefähr so groß wie Frankreich. Die Armee hält weiterhin Teile des Ostens und Nordens, kann dort jedoch vielerorts kaum Verwaltung oder öffentliche Versorgung gewährleisten. Rund 25 Millionen Menschen – etwa die Hälfte der Bevölkerung – leiden laut UN unter Hunger. Mindestens 50.000 kamen im Verlauf des Krieges ums Leben, einige Schätzungen gehen von bis zu 150.000 Toten aus. UN-Organisationen wie Unicef sprechen längst von der „größten humanitären Krise der Welt“.
Viele Familien versuchen, in Nachbarstaaten Zuflucht zu finden. Rund vier Millionen Sudanesen sind seit Beginn des Krieges in Länder wie Tschad, Ägypten, Südsudan oder Äthiopien geflohen. Die Mehrheit bleibt also in der Region – aufgrund geografischer Nähe, der Kosten und familiärer Netzwerke. „Es ist nicht der Wille, der Menschen daran hindert, vermehrt in Industrienationen zu fliehen, sondern es sind die finanziellen Mittel“, sagt Hafiz Ismail Mohamed von der sudanesischen Denkfabrik Justice Africa.
„Um nach Europa zu gelangen, braucht man mindestens 5000 Dollar. Das haben die meisten Menschen nicht.“ Viele jener, die aus dem Sudan in die Grenzregionen der Nachbarländer geflüchtet seien, hätten schlicht keine Alternative gehabt. „Wer die Möglichkeit hatte, in besser entwickelte Länder zu flüchten, hat das zu Beginn des Krieges getan.“
Die Vorstellung, dass eine große Zahl Sudanesen bald nach Europa aufbrechen werde, sei daher irreführend. „Es wird keinen plötzlichen Exodus geben. Vielleicht ein bis zweitausend Menschen“, so Mohamed. „Die sudanesische Diaspora ist erschöpft. Die meisten Familien in Sudan leben inzwischen von Überweisungen von Verwandten im Ausland. Aber auch diese Menschen haben keine Rücklagen mehr.“
Flucht in die Nachbarländer
Mit Blick auf mögliche Fluchtbewegungen nach Europa erwartet auch Ulf Laessing, Leiter des Sahel-Programms der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, zunächst keinen signifikanten Anstieg infolge der jüngsten Entwicklung in Darfur. „Die meisten Flüchtlinge werden weiterhin in den Nachbarländern Zuflucht suchen“, sagt Laessing. So wie seit Kriegsbeginn im April 2023.
Zuletzt hatte es nach der Einnahme von Khartum durch die Armee im März einen Schub gegeben. Damals seien nach Angaben von Helfern allein im Tschad zeitweise um die 15.000 Menschen pro Woche an der Grenze angekommen. Die Behörden hätten dort sogar begonnen, die Ankommenden zu trennen: zwischen jenen, die als RSF-nah galten, und jenen, die vor der RSF flohen, „um Konflikte in den Camps zu vermeiden“.
Gleichzeitig warnt Laessing vor den Folgen der anhaltenden Kürzungen internationaler Nothilfe. Das Welternährungsprogramm der UN habe bereits „die Rationen halbiert“ – und werde dies voraussichtlich „noch einmal im Januar“ tun, sagt er. „Dann stellt sich die Frage, was die Menschen machen. Viele können nicht zurück in den Sudan. Und wenn es in den Lagern nicht reicht, werden einige versuchen, weiterzuziehen.“ Wenn der Tschad destabilisiert wird, könne das dazu führen, dass einige den Aufbruch in Richtung Mittelmeer zumindest riskieren. „Das ist dann auch eine Frage, wie schnell sich Schleuser organisieren“, so Laessing.
Der Blick auf die Statistik offenbart einen Anstieg, wenn auch auf niedrigem Niveau. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 wurden in Europa 484 neu angekommene sudanesische Schutzsuchende registriert – etwa 38 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig wurden rund 900 Sudanesen auf dem Weg nach Europa von der libyschen Küstenwache abgefangen.
Christian Putsch ist Afrika-Korrespondent. Er hat im Auftrag von WELT seit dem Jahr 2009 aus über 30 Ländern dieses geopolitisch zunehmend bedeutenden Kontinents berichtet.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.