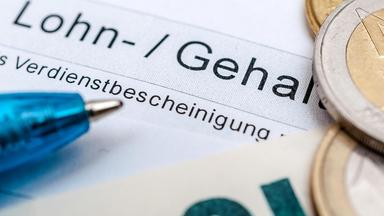Der Bundestag entscheidet heute, ob eine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie eingesetzt wird. Experten halten das für überfällig, um Wunden zu heilen und das Land besser für künftige Krisen aufzustellen.
Rot-weißes Flatterband sperrt Spielplätze ab, leere Straßen, Theater sind ebenso geschlossen wie Restaurants oder Bars. Kinder dürfen nicht in die Kita, Unterricht findet nur vor dem Bildschirm statt und Masken werden verpflichtend zum ständigen Begleiter.
Die Corona-Pandemie war ein Ausnahmezustand. Einer, der noch immer nachwirkt und Fragen hinterlassen hat. Während medizinisches Personal in Kliniken um das Leben von Erkrankten kämpfte, musste die Politik weitreichende Entscheidungen treffen.
Was lief gut? Welche Entscheidungen waren fragwürdig? Und wie sollte Politik in einer solchen Ausnahmesituation künftig handeln? Mehr als zwei Jahre, nachdem die letzten Corona-Maßnahmen endeten, soll eine sogenannte Enquete-Kommission Antworten auf diese Fragen finden.
Was kann eine Enquete-Kommission leisten?
Enquete bedeutet Befragung oder Untersuchung. Eine solche Kommission soll vereinfacht gesagt Informationen und Erkenntnisse zusammentragen. Das Ziel sind Empfehlungen für Entscheidungen des Bundestags. In diesem Fall soll die Kommission ein Gesamtbild der Pandemie erstellen. Es geht um einen Blick zurück, aber auch um den Blick nach vorne.
In ihrem Antrag schreiben Union und SPD, dass die Kommission Ursachen, Verlauf und Folgen der Pandemie aufzeigen soll. Daten und Fakten zur Pandemie sollen offengelegt werden, um Transparenz zu schaffen. Die Maßnahmen in der Zeit, etwa Schulschließungen oder Ausgangssperren, sollen aufgearbeitet werden.
Markus Grill, ARD Berlin, zur geplanten Enquete-Kommission zur Corona-Aufarbeitung
tagesschau24, 10.07.2025 11:00 UhrEine große Aufgabe, findet die Soziologin Jutta Allmendinger, die Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Im besten Falle könne aber Vertrauen in die Politik und den Rechtsstaat, das verloren gegangen sei, zurückgewonnen werden. "Wenn die Politik zeigt: Wir haben tatsächlich Fehler gemacht und zu diesen Fehlern stehen wir."
Außerdem ist es aus Allmendingers Sicht entscheidend, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Dazu gehören Familien, die immer noch unter den Folgen der Pandemie leiden, Long-Covid-Betroffene oder Menschen, die ihre Angehörigen nicht beim Sterben begleiten durften.
Umgang mit Ungeimpften
Ein Thema, das damals kontrovers diskutiert wurde, ist die Impfpflicht. Auch der Umgang mit Ungeimpften hat zu vielen Meinungsverschiedenheiten und Gräben in der Gesellschaft geführt.
Aus Sicht von Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski gab es damals "massive Diskriminierungen". Die Ungleichbehandlung von Menschen, je nachdem, ob geimpft, oder ungeimpft, sei nicht gerechtfertigt gewesen. Rostalski, ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat, geht es hier auch um die Frage des Minderheitenschutzes.
"Ich denke, dass wir das unbedingt als Gesellschaft in der Enquete aufarbeiten müssen", sagt sie. Die Fehler gegenüber Ungeimpften müssten benannt werden. Viele fühlten sich immer noch ungerecht behandelt und stigmatisiert.
Zusammensetzung der Kommission
Der Kommission sollen Mitglieder aller Fraktionen des Bundestags angehören und Sachverständige aus Wissenschaft und Praxis. Sie müssen noch bestimmt werden.
Für Rostalski hängt der Erfolg der Kommission auch von der Besetzung ab. Sie sagt, dass eine offene und kritische Aufarbeitung nur gelingen kann, wenn auch Experten zu Wort kommen, die in der Pandemie nicht so gehört wurden. "Um Vertrauen zu schaffen, sollten nicht wieder dieselben Stimmen zu Wort kommen, die gesagt haben, dass alles richtig läuft. Man sollte vielleicht auch Stimmen zu Wort kommen lassen, die weniger befangen sind und weniger über ihre eigene Rolle nachdenken müssen."
Handlungsempfehlungen für die Zukunft
Es geht vor allem darum, für kommende Krisen besser gerüstet zu sein. Die Kommission soll dafür in zwei Jahren einen Abschlussbericht als Empfehlung für den Bundestag vorlegen.
Es geht um Fragen wie Pandemiepläne und Entscheidungsstrukturen. Wie können Bund und Länder in Ausnahmesituationen besser zusammenarbeiten? Sind stundenlange Ministerpräsidentenkonferenzen wirklich eine gute Lösung? Aus Sicht von Rechtswissenschaftlerin Rostalski nicht. "Gerade in Krisenzeiten, wenn es auch um solche starken Eingriffe in die Freiheitsrechte geht, muss der Bundestag, das Parlament, erste Stimme sein."
Doch was passiert am Ende mit dem Abschlussbericht? Die Handlungsempfehlungen der Kommission sind nicht bindend. Sie sollten aber nicht einfach in einer Schublade verschwinden, fordert die Soziologin Allmendinger: "Dieses Papier muss dann zum Leben erweckt werden." Aus ihrer Sicht müssen die Ergebnisse mit den Menschen deutschlandweit besprochen werden, etwa in Bürgerforen.
Allmendinger ist überzeugt, dass es auch zu Schuldzuweisungen kommen wird. Ein Problem sieht sie darin aber nicht. "Der Sinn der Sache ist der Streit", meint die Soziologin, "um zu zeigen, dass wir zu solch einer demokratischen Kultur fähig sind."
Dafür müssten sich aber alle mit Respekt begegnen und sich an Spielregeln halten. Dann sei Streit "quasi der Weg zum Ziel, vielleicht ist es sogar das Ziel". Dass am Ende mit der Kommission alle Wunden geheilt werden können, glaubt sie nicht. "Aber wenn die Wunden auch nur benannt werden und nicht so getan würde, als ob es keine Wunden gäbe, dann wäre meines Erachtens schon viel erreicht."
Unterschied zum Untersuchungsausschuss
Rechtswissenschaftlerin Rostalski hätte einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung besser gefunden, weil er mehr Instrumente zur Verfügung hat. In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss sitzen nur Abgeordnete. Hier liegt der Fokus auf der Aufklärung von potenziellen Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. Der Ausschuss soll herausfinden, wer dafür die politische Verantwortung trägt.
Anders als eine Enquete-Kommission kann ein Untersuchungsausschuss Beweismittel anfordern, Sachverständige und Zeugen vernehmen. Wenn man dort falsche Aussagen macht, kann das strafbar sein.
"Der Vorteil beim Untersuchungsausschuss ist, dass er in gewisser Weise das schärfere Schwert ist", sagt Rostalski. Sie hofft, dass in der Enquete "auch die Vergangenheit stark aufgearbeitet wird, sodass wir dann eben noch so eine Art Untersuchungsausschuss light bekommen".
Dietrich Karl Mäurer, ARD Berlin, tagesschau, 10.07.2025 08:35 UhrHaftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.