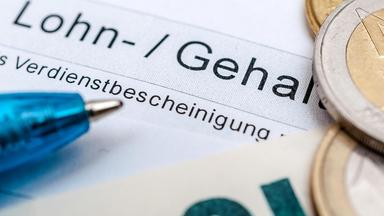Nachwuchswissenschaftler in Berlin sollten entfristet werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat nun die Regelung im Berliner Hochschulrecht aufgehoben.
#IchbinHanna - unter diesem Hashtag schilderten im Jahr 2021 viele Nachwuchswissenschaftler ihre schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen: Es geht um Kettenbefristungen, schlechte Bezahlung, viel Arbeit und wenig Anerkennung. Gerade die Befristungen stellen eine erhebliche Belastung für viele junge Forschende dar.
Unbefristete Stelle nur zu bestimmten Zeitpunkten
In der Regel können Nachwuchswissenschaftler sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion an den Universitäten beschäftigt werden. Wer danach keine unbefristete Stelle oder eine Professur bekommt, hat es schwer und muss meist den akademischen Betrieb verlassen.
Für Constanze Baum, Vorstandssprecherin der Landesvertretung Akademischer Mittelbau Berlin, sind Bewährungsproben für Nachwuchswissenschaftler zumindest vor der Promotion sinnvoll: "Aber mit der Promotion, die quasi das Meisterstück in der wissenschaftlichen Karriere ist, sollten viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um solch einem Befristungswahnsinn vorzubeugen." Sich alle zwei Jahre überlegen zu müssen, wo man eine Anschlussstelle bekomme, lähme auch die wissenschaftliche Tätigkeit, so Baum.
Berliner Sonderweg
Wohl unter dem Eindruck von #IchbinHanna schlug die damalige rot-rot-grüne Berliner Regierung einen Sonderweg ein. Ende 2021 wurde eine neue Regelung in das Landeshochschulgesetz eingefügt: Wissenschaftliche Mitarbeiter mit Doktorgrad sollten eine dauerhafte Stelle bekommen, wenn sie ein Qualifikationsziel, zum Beispiel eine Habilitation, erreichen.
Die Berliner Hochschulen protestierten vehement gegen diese Änderung. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, trat aus Protest sogar zurück. Die Kritik: Die unbefristeten Stellen könnten nicht finanziert werden und es gebe dann keinen Platz mehr für die nächste Generation von Nachwuchsforschern.
Humboldt-Universität ging nach Karlsruhe
Die Humboldt-Universität legte deshalb Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein - mit Erfolg. Die Regelung sei nicht mehr von der Gesetzgebungsbefugnis des Landes gedeckt, so Carla Köhler, Pressesprecherin am Bundesverfassungsgericht: "Der Bundesgesetzgeber hat in diesem Bereich abschließende Regelungen dahingehend getroffen, dass die Arbeitsverträge ohne weitere Voraussetzungen befristet werden können."
Die praktischen Auswirkungen dieser Entscheidung für die Berliner Wissenschaft sind jedoch gering. Die Entfristungsregel wurde bisher nicht angewendet. Der Start wurde mehrfach vom Berliner Senat verschoben, zuletzt auf unbestimmte Zeit. Mit der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde ist der Berliner Sonderweg nun endgültig vom Tisch.
Hoffnungen liegen jetzt auf dem Bund
Constanze Baum setzt nun auf den Bund: "Ich hoffe, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zeitnah angepasst wird und endlich von dort entscheidende Reformen ausgehen." Eigentlich wollte noch die Ampelkoalition das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren. Doch schon am Gesetzesentwurf gab es viel Kritik von Gewerkschaften, Forschern und Studierendenvertretungen. Letztlich scheiterte das Vorhaben auch am frühzeitigen Ende der Ampelkoalition.
Die neue schwarz-rote Bundesregierung möchte einen neuen Versuch starten und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis Mitte 2026 reformieren.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.